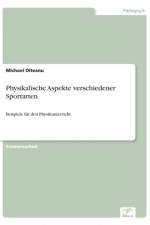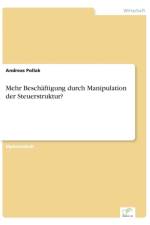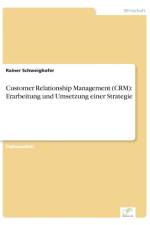- Gesellschaftliche Individualisierung und soziale Arbeit
av Matthias Weiss
1 021
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Grundlage meiner Betrachtung ist der Prozeß der Individualisierung. Im Zentrum dieser Arbeit steht der Mensch - Mittelpunkt meiner angehenden beruflichen Arbeit. Da es nicht möglich ist, alle Facetten des Individualisierungsprozesses in einer Diplomarbeit auszuleuchten, spezifiziere ich mich auf die Grundlagen und Folgen, die sich mir am wichtigsten und weitreichendsten darstellen. In Kapitel 1.1 gebe ich einen ersten Überblick über Tendenzen einer individualisierten Gesellschaft. Außerdem grenze ich Individualisierung vom Modernisierungsprozeß anhand eines idealtypischen Dreiecksmodell, in Anlehnung an Talcott Parsons idealtypischen Vierecksmodell, ab. Dieser Schritt wird nötig, da ich nicht den ganzen Modernisierungsprozeß bearbeiten will, sondern mich auf Individualisierung beschränke. Ich stellte fest, daß die anderen beiden Dimensionen von Parsons Modell, Rationalisierung und Differenzierung, zugleich Grundlage vom Individualisierungsprozeß sind, die sich gegenseitig bedingen. Dementsprechend gehe ich auf diese beiden Dimensionen gesondert ein und forme daraus das idealtypische Dreiecksmodell mit den Dimensionen Rationalisierung, Differenzierung und Individualisierung, als Grundlage meiner Arbeit. Der durch den Modernisierungsprozeß eingeleitete Umbruch der Werte ist die wichtigste Grundlage für den modernen Pluralismus, der seinerseits ein wichtiges Element moderner Individualisierung ist. Kapitel 1.2 beschäftigt sich mit der Pluralisierung der Werte, subjektiver und intersubjektiver Sinnkrise, intermediären Institutionen und der postmodernen Theorie. Daneben stelle ich noch die Wertesynthese von Helmut Klages, als positives Beispiel gelungener Wertintegration vor. Da der Pluralismus nicht nur Werte beeinflußt, die ihrerseits den Menschen maßgeblich prägen, sondern auch das Individuum selbst, war es für mich unmöglich, Pluralismus aus der Auswahl möglicher Individualisierungsthemen zu streichen. Nachdem die wichtigsten Grundlagen bearbeitet sind, wende ich mich dem Menschen zu und betrachte in Kapitel 2 individuelle Folgen für individualisierte Bürger. Zuerst beschäftige ich mich mit der kontroversen Freiheit, die durch Individualisierung entstanden ist. Auf der einen Seite steht eine neue Unabhängigkeit durch Enttraditionalisierung, auf der anderen Seite eine neue Abhängigkeit von vielfältigen Organisationen. Danach betrachte ich die Diskussion um den Tod des Subjektes, die in letzter Zeit immer [¿]