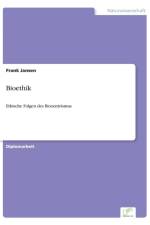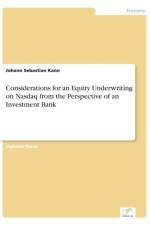- Ethische Folgen des Biozentrismus
av Frank Jansen
1 361
Inhaltsangabe:Einleitung: Gott ist tot. Gerade in der Debatte um Reproduktionsmedizin und Molekularbiologie wird ersichtlich, dass die Zeiten von Immanenz und Transzendenz, im Hinblick auf Erlösung und Verschiebung von Problemstrukturen auf das Jenseits, der Vergangenheit angehören. Der Mensch ist zum ?Meister? seiner eigenen Disposition geworden und liegt in der Debatte um die daraus resultierende Ethik und Moral um Jahrhunderte zurück. Schon seit Jahrtausenden macht sich der Mensch Gedanken über schöne, gesunde und gute Nachkommen. Sokrates und Glaukon forderten Gesetze, damit nur die besten Männer mit den besten Frauen möglichst oft, und die schlechtesten Männer mit den schlechtesten Frauen möglichst wenig verkehren durften. Verlockend der Gedanke das Krankheiten schon in ihrer genetisch angelegten Struktur verhindert werden kann. Geradezu zynisch zu wissen das eine Gesellschaft ohne ?Schwache und Verlierer? nicht funktionstüchtig sein kann. Das biologische Schicksal ist voraussehbar, planbar und korrigierbar geworden und lässt nur erahnen, welches Potential an Kontrollierbarkeit hier möglich ist. Sicher ist allerdings eines, wir werden uns über eine völlig neue Konstruktion Mensch unterhalten müssen, und es wird auch unabdingbar sein demzufolge über eine völlig andere, noch nicht vorhersehbare Gesellschaftsordnung zu sprechen. In der gesamten Biodiskussion sind die Demarkationslinien noch nicht klar gezogen und bieten daher in erster Linie für viele Menschen Unsicherheit und Unverständnis angesichts eines so umfassenden Themenkomplexes. Aber eines dürfte sicher sein. Endlich haben wir es geschafft. Endlich sind wir Herr, wenigstens auf biologischer Ebene, Herr unser selbst. Der letzte Schritt zur Individualisierung mit Rückgabegarantie ist getan und die Gewissheit besser sein zu können als die Schöpfung je sein konnte, ist endlich in greifbare Nähe gerückt. Die neuen Dispositionen ähneln einem fundamentalistischen Individualisten, eine Überforderung, eine biologische Atombombe auf geistiger Ebene. Wir sind nicht nur dazu verdammt worden die eigene Anthropologie neu zu konzipieren, ja sogar soweit zu verändern und jederzeit beliebig neu verändern zu können, wir sind auch dazu verdammt worden allem einen neuen Sinn geben zu müssen. Der Urzustand, die biologische Grenze, ist erobert und kann neu platziert werden. Wir sind zum Korrekturleser unser selbst degradiert. Tatsache ist, dass die gesamte Diskussion um Bioethik und die daraus [¿]