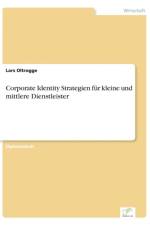- Epidemiologie von Alkohol- und Medikamentenabhangigkeit im dritten Lebensabschnitt und ihre Bedeutung fur die Sozialarbeit
av Geb Lais Maria Voegtle
1 077
Inhaltsangabe:Einleitung: Es gilt dem Leben nicht nur Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. Langlebigkeit verpflichtet uns aber auch zu einem "gesunden Alter". Es kommt nicht darauf an, wie ALT man wird, sondern WIE man alt wird. Ein Leben lang altern, ein Schicksal, das uns alle betrifft. Bin ich mir dessen bewußt? Und dann bleibt noch die Frage, was "gesundes Altern" bedeutet. Gesundheit ist nach der WHO-Definition "körperliches, seelisch-geistiges und soziales Wohlbefinden". Es kommt also nicht nur auf den medizinischen, sondern auch auf den sogenannten "subjektiven Gesundheitszustand' an. ( Lehr in: Sozialministerium 1997, 13) Was passiert wenn sich jemand nicht gesund fühlt, wenn das Alter zur Last wird? Es ist leicht verständlich, daß die betroffene Person nach Hilfsmitteln Ausschau hält, die schnelle Linderung versprechen. Handelt es sich bei den Hilfsmitteln um Medikamente und Alkohol, kann sich der scheinbare Problemlöser durch übermäßigen, länger anhaltenden Konsum als Problemverstärker, im Sinne einer Suchtmittelabhängigkeit entwickeln. Alte Menschen, die ihr aus welchem Grund auch immer empfundenes Unwohlsein mit Medikamenten und/oder Alkohol zu lindern versuchen, sind Zielgruppe der vorliegenden Diplomarbeit. Gang der Untersuchung: Das erste Kapitel ist mit "Alter und Altern in unserer Gesellschaft" überschrieben. Ältere Menschen bildeten schon immer einen Teil der Gesellschaft. Erst in neuerer Zeit werden sie als ein soziales Problem empfunden. Dies vor allem, da sich der Anteil der über 65jährigen an der Gesamtbevölkerung der hochentwickelten Gesellschaft in den letzten hundert Jahren verdreifacht hat und für das Jahr 2020 mit einem Drittel alter Menschen an der Gesamtbevölkerung gerechnet wird. Hintergründe für dieses Phänomen, das Erscheinungsbild der alten Menschen und mögliche belastende Situationen in denen sie leben, sind Inhalt des ersten Kapitels. Ein mögliche Lösungsstrategie von Belastungen im Alter ist die Flucht in die Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit. Bei süchtigen alten Menschen trifft man gleich auf zwei Tabuthemen: Alter und Sucht. Ob es sich dabei lediglich um ein kleines Grüppchen von Außenseitern oder um die Spitze eines Eisbergs handelt, wird im zweitenKapitel eruiert. In dritten Kapitel wird die Bedeutung von Alter und Sucht für die Sozialarbeit aufgezeigt. Im Abschnitt "Nachgefragt" haben alte Menschen und Praktiker die Möglichkeit erhalten, zum jeweiligen Thema ihre Erfahrungen und [¿]