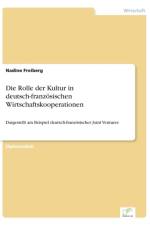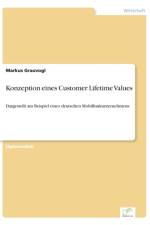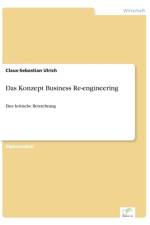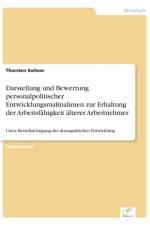- Eine kritische Betrachtung
av Claus-Sebastian Ulrich
1 187
Inhaltsangabe:Einleitung: ?Es gibt kein einziges Unternehmen, dessen Management nicht ? zumindest für die Ohren der Öffentlichkeit ? proklamiert, es strebe eine Organisation an, die flexibel genug ist, um sich an rasche Veränderungen der Marktbedingungen anzupassen, schlank und innovativ genug, um Produkte und Dienstleistungen technisch auf dem neusten Stand zu halten, und engagiert genug, um ein Maximum an Qualität und Kundenservice zu bieten.? Durch die Globalisierung der Märkte, der dynamischen und komplexen Entwicklung der Technologien und nicht zuletzt durch den verstärkten internationalen Wettbewerb, ist eine tief greifende Veränderung im Managementverhalten unentbehrlich. Zahlreiche Branchen werden mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Insofern besteht die unabdingbare Notwendigkeit, sich diesen veränderten Rahmenbedingungen in adäquater Weise anzupassen, um künftige potentielle Krisen besser überwinden zu können. Eine grundlegende Voraussetzung für internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist die effiziente Gestaltung betrieblicher Geschäftsprozesse. ?Zweihundert Jahre lang folgten die Menschen bei der Gründung und beim Aufbau von Unternehmen der brillanten Entdeckung von Adam Smith, dass industrielle Arbeit in ihre einfachsten und grundlegendsten Aufgaben zerlegt werden sollte.? Der Gedanke des Teilens der Arbeit in kleinste Verrichtungsstufen, die damit verbundene Steigerung der Produktivität sowie das Sinken der Stückkosten ist auch heute noch stark in den Organisationsformen von Unternehmungen verankert. Durch den Wandel von Verkäufermärkten zu Käufermärkten, durch die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und durch die Notwendigkeit schnellerer Reaktionszeiten im Wettbewerb wird dem Aufbau und der Entwicklung von Unternehmensorganisationen eine immer stärkere Aufmerksamkeit gewidmet. Es genügt nicht, sich mit den gegenwärtigen Unternehmenserfolgen abzufinden, sondern es muss ausreichend Weitblick vorhanden sein, um sich auf neue Marktbedingungen einstellen zu können. Dies fordert von den Unternehmungen die Bereitschaft zum ?Wandel?. Es geht heute mehr denn je um Themen wie Flexibilisierung, Beweglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und um Reaktionsschnelligkeit innerhalb der Unternehmung und am Markt. ?Unternehmen, deren Organisation sich [lediglich] an Arbeitsteilung und Spezialisierung ausrichtet, sind diesen Herausforderungen häufig nicht gewachsen.? Wie jedoch soll sich dieser Wandel vollziehen? Eine der [¿]