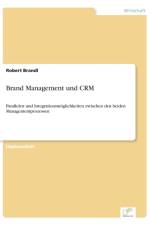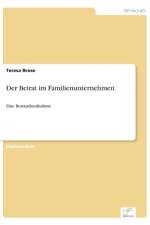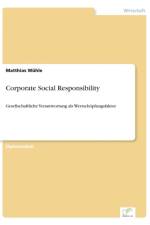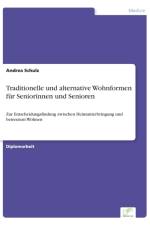- Dargestellt anhand des Entsendungslandes Indien im Hinblick auf kulturelle, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte
av Nadja Israel
1 097
Inhaltsangabe:Problemstellung: Während die Situation am Weltmarkt immer komplexer wird, sich der internationale Wettbewerb verschärft, die Kundenanforderungen steigen und sich der Lebenszyklus der Produkte und Erzeugnisse verkürzt, wird es für Unternehmen immer wichtiger, weltweit einen gleichen Verfahrens- und Qualitätsstandard zu bieten, aber dennoch flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können. Dies sind nur einige Aspekte, die Entsendungen von Mitarbeitern ? so genannten Expatriates ? notwendig machen, um Kundenkontakte und Auslandsgesellschaften aufzubauen, Aufträge abzuschließen und Projekte zu realisieren. Die hohe Bedeutung von Auslandsentsendungen ist in der Literatur vielfach bestätigt worden. Doch schätzen Experten, dass die Quote der vorzeitigen Abbrüche zwischen 10 ? 40 % schwankt, in Entwicklungsländern wächst diese Zahl auf bis zu 70 % an. Dies deutet auf Mängel bei der Entsendungsgestaltung hin, die die Personalauswahl, die Vorbereitung und Betreuung vor Ort sowie die Wiedereingliederung im Stammunternehmen beinhalten. Die Gestaltung der Entsendung orientiert sich an der Strategie des Unternehmens und ist u. a. abhängig von den Unternehmenszielen und der Marktpositionierung. Die Entsendung in ein anderes Land ist bis zu einer Dauer von drei Monaten i. d. R. unproblematisch und erfordert keinen besonderen Handlungsbedarf. Erst darüber hinaus können tiefgreifende Probleme auftreten, die den Erfolg der Entsendung maßgeblich beeinflussen. Eines der Hauptproblemfelder beschäftigt sich mit der kulturellen Vielfalt innerhalb eines weltweit agierenden Unternehmens. Darum entstand der Begriff des ?Diversity Managements?, der sich mit dem positiven Potenzial einer ?multikulturellen? Belegschaft auseinandersetzt. Diese Arbeitnehmerschaft unterscheidet sich durch Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Hautfarbe, Bildungsgruppe etc. Die Unterschiedlichkeit der Menschen kombiniert mit ihren verschiedenen Potenzialen, können den Unternehmenserfolg entscheidend bestimmen. Die Kosten einer Auslandsentsendung werden vorrangig durch die Person des Expatriates, die Unternehmensziele und die Umweltbedingungen des Gastlandes bestimmt. Der Entsandte bestimmt mit seiner Gehaltsforderung einen Großteil der Kosten. Weiterhin werden entsprechend seiner Aufgaben und seinen Kenntnissen Maßnahmen nötig, um ihm das notwendige Know-how für seinen Einsatz zu verschaffen. Dazu gehören bspw. Sprachschulungen, interkulturelle Trainings als auch die [¿]