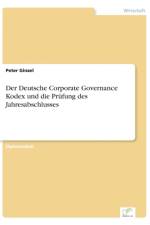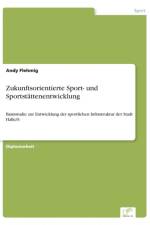- Entscheidungen bei Malaria, Atemwegserkrankungen und Enteroparasiten im Licht soziokultureller Faktoren
av Claudio Priesnitz
1 281
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Auf Feldforschung beruhende Untersuchung (2003) im größten zusammenhängenden Regenwaldgebiet Mesoamerikas (Uaxactún/ Tikal, Maya-Biosphären-Reservat), welche die individuellen Überlegungen zur Wahl der Behandlungsalternativen synthetisch produzierte Pharmaka oder natürliche Heilpflanzen (aus der direkten Umgebung des Dorfes) gegenüberstellt und evaluiert. Darstellung der Behandlungsalternativen, ethnomedizinische Theoriebildung auf Grundlage der kognitiven Anthropologie, Untersuchungsmethoden und Soziographie/ Ethnographie Uaxactúns. Quantitative (SPSS-Kreuztabellen-Signifikanzen: Pearson¿s Chi-Square-Test) und qualitative (individuelle Fallbeschreibungen) Analyse der Ergebnisse. Im Anhang Ethnobotanik der gebräuchlisten Heilpflanzen für Malaria, Enteroparasiten (Durchfall, Amöben, Giardia), Atemwegserkrankungen (Husten, Schnupfen, Grippe, Entzündungen), Haut-Leishmaniase, Diabetes, Nierenprobleme, Hautkrankheiten allgemein, Krebs, Schlangenbisse (spez. Bothrops asper), Böser Blick (mal de ojo), susto etc. unter Angabe der lokal verwendeten und wissenschaftlichen Pflanzentermini und -familien. Kartenmaterial, ausführliche Literaturangaben, Photos, Tabellen, Grafiken. Struktur der Arbeit: Nach einer allgemeinen Einführung in die Thematik und die ethnologische Relevanz der vorliegenden Arbeit, wird in Kapitel 2. auf die konkreten Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch die Vor- und Nachteile des Untersuchungsraumes dargelegt. Es folgt in Kapitel 3. die Entwicklung der Theoriebildung und Untersuchungsmethoden der Arbeit. Vor diesem Hintergrund werden im Anschluss daran wesentliche Definitionen der in dieser Arbeit gebräuchlichen ethnomedizinischen und ortstypischen Begrifflichkeiten gegeben, um so den Rahmen der Arbeit genauer abzustecken. Anschließend wird in Kapitel 5 eine ethnografische Darstellung der örtlichen Gegebenheiten präsentiert. Mit diesem Vorwissen können die generell vorhandenen Behandlungsalternativen in Kapitel 6. erläutert und in den nationalen bzw. mesoamerikanischen Kontext eingeordnet werden, bevor in Kapitel 7. auf die Krankheiten und ihre speziellen Behandlungsmethoden im Einzelnen eingegangen wird. Im Anschluss daran folgt in Kapitel 8. eine Beschreibung und Evaluation der Entscheidungsfindungsprozesse anhand von Fallbeispielen, nach Krankheiten sortiert. Vor dem Hintergrund der Präsentation der deskriptiven Ergebnisse kann [¿]