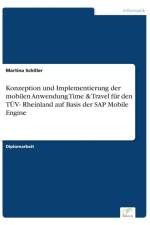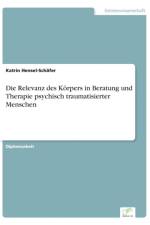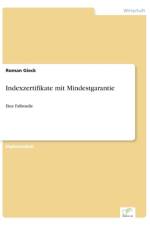av Andreas Klebs
1 281
Inhaltsangabe:Einleitung: Im Jahr 2003 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland etwa 39.000 Betriebe mit jeweils mehr als 100 Beschäftigten. Davon offerieren ca. 14.000 Unternehmen ihren Mitarbeitern eine warme Mahlzeit. Zwei Drittel davon bewirtschaften eine eigene Küche, die übrigen lassen sich das Essen anliefern, warm oder tiefgekühlt, in sehr seltenen Fällen im Cook-&-Chill-Verfahren. Je größer das Unternehmen, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter verpflegt werden. Größere Betriebe sind auch eher bereit und in der Lage, das Essen zu bezuschussen. Die Frage nach der Betriebsform, in der die Verpflegung organisiert ist, Eigenregie, Catering oder Pacht, gehört seit langem zu den zentralen Fragen in der Gemeinschaftsverpflegung. Letzte Schätzungen ergaben, dass die Catering-Quote bei etwa 25 % liegt. Der größte Teil der Betriebsgastronomie in Deutschland ist im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Ländern mit 57 % immer noch Sache der Unternehmen selbst. Der Rest liegt in den Händen von kleinen und mittelständigen Pächtern. Jedes Unternehmen das sich neu gründet, umstrukturiert oder auch verkleinert steht vor der Frage, welches Verpflegungssystem für seinen Betrieb als günstigstes zum Einsatz kommen kann. Die Qualität der Versorgung spielt natürlich eine entscheidende Rolle; aber auch betriebswirtschaftliche Erwägungen sind zu betrachten. Vergleiche in der Literatur zwischen den einzelnen Versorgungsformen sind sehr schwer, wenn überhaupt nicht zu finden, da jeder Betrieb seine eigene Struktur hat. Viele Geschäftsführungen, die ihre Mitarbeiter optimal verpflegen wollen glauben, durch eine eigene Großküche, mit eigenem Personal das bestmögliche zu erreichen. Sehr häufig gehen diese Küchen nur kurz oder gar nicht in Betrieb. In der Praxis sind sehr viele solcher ?Investruinen? bekannt, die in bester Absicht gebaut und eingerichtet, aber aufgrund zu hoher Folgekosten wieder geschlossen wurden. Falsche Beratungen waren nicht selten der Grund dafür. Am stärksten hiervon betroffen sind Unternehmen zwischen 100 und 600 Mitarbeiter. Ziel der Arbeit: Ziel dieser Arbeit ist es, aus betriebswirtschaftlicher Sicht einen Vergleich anzustellen, der den Unternehmer, bevor er überhaupt Investitionen tätigt, in die Lage versetzt, sein optimales System der betrieblichen Gemeinschaftsverpflegung zu finden. Beispielrechnungen mit 25 bis 500 Essenteilnehmern der Systeme Eigenregie, Voll- und Teilcatering und Tiefkühlküchen [¿]