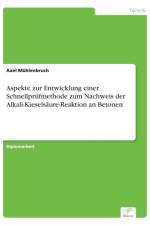- Eine Analyse der Informationsarmut in der Informationsflut unter besonderer Berucksichtigung von E-Mail und Intranet
av Silke Wingens
1 211
Inhaltsangabe:Problemstellung: Eine Studie der School of Information Management an Systems (SIMS) der University of California, Berkley ergab, dass innerhalb von drei Jahren (2001 ? 2004) weltweit mehr Informationen erzeugt werden als in den letzten 300.000 Jahren zusammen erzeugt worden sind. Das Gesamtvolumen aller verfügbaren Informationen (in gedruckter Form, über Radio/ TV verbreitet oder auf optischen/ magnetischen Datenträgern gespeichert) betrug 2001 12 Exabyte. Diese gewaltige Datenmenge wird an einem Beispiel deutlicher: Der Mensch kann ca. 3 ? 50 Zeichen pro Minute bewusst verarbeiten. Würde er sich alle diese Informationen aneignen wollen, würde er dafür zwischen 8,5 und 141,4 Milliarden Jahre benötigen (vgl. Sterner). Obwohl der einzelne Mensch nicht alle verfügbaren Informationen benötigt, ist die Menge der auf ihn einströmenden Informationen äußerst hoch: Bereits im Jahre 1980 hat jeder Amerikaner nur 0,44% des Informationsangebotes (Bücher, Zeitungen, Fernsehen, Radio, Telefon,.) genutzt (vgl. Bork). Diese Zahl währe nicht bedenklich, wenn jeder die Informationen, die er benötigt, auch erhalten würde und aus der Informationsflut herausfiltern könnte. Durch die Menge an Informationen wird es zunehmend schwieriger, die wirklich relevanten Informationen von den nicht relevanten zu trennen. Es entsteht ein Informationsparadoxon; Inmitten der Informationsflut herrscht ein Informationsmangel (vgl. Königer/Reithmayer). Diese sogenannte Informationsverschmutzung hat besonders bei Unternehmen große Auswirkungen, da Informationen die notwendige Basis für alle Entscheidungen sind. Eine starke Informationsverschmutzung kann zum Absinken der Entscheidungseffizienz, Erhöhung von Durchlaufzeiten, zu gesundheitlicher Belastung und damit verbundenen Fehlzeiten der Mitarbeiter führen. (vgl. Bork). Die neuen Medien haben diese Informationsverschmutzung noch verstärkt. Bedenkt man, dass das Internet bereits im Jahre 2001 aus 2,5 Milliarden direkt ansurfbaren Oberflächen bestand und täglich um 7,3 Millionen Seiten wuchs kann man das Ausmaß der Informationsverschmutzung erahnen. Per Email wird sogar 500 Mal soviel an Informationen produziert wie durch die Produktion von Webseiten (vgl. Berndt). Da in Unternehmen oft Informationen über das Intranet abrufbar sind, ist auch hier ein besonderes Augenmerk auf eine gute Informationsversorgung zu legen. Es ist von enormer Wichtigkeit für alle Unternehmen, das Problem der Informationsverschmutzung [¿]