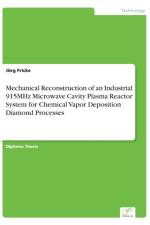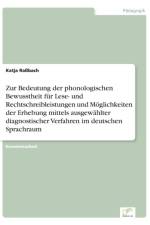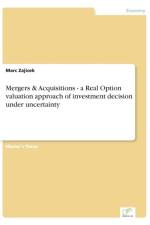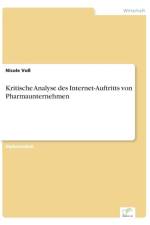av Christian Hiebl
1 211
Inhaltsangabe:Abstract: Nowadays, database management systems (DBMS) play a central role in the realization of modern information systems for efficient storage, management and retrieval of large amount of data. At the same time, the eXtensible Markup Language (XML) is emerging fast as de facto standard for electronic data exchange. In order to be able to benefit from both technologies, a number of approaches have already been developed, aiming at the integration of XML and DBMS. They allow processing XML data on the basis of declarative query languages, don?t pay however much attention to the manipulation of XML data. The objective of this diploma thesis is to implement X-Ray QL, a declarative query and data manipulation language for X-Ray, an integration approach using the idea of a meta database. X-Ray QL allows besides creating, editing and deleting XML data in a declarative way, to retrieve the XML data using simple select queries. The implementation of X-Ray QL consequently provides an operative runtime part of the X-Ray architecture with features like session management, authorisation mechanism and transaction control. An additional Web Service demonstrates the practical use of the X-Ray QL implementation. Zusammenfassung: Datenbankmanagementsysteme (DBMS) spielen heutzutage eine zentrale Rolle bei der Realisierung moderner Informationssysteme zur effizienten Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung großer Datenmengen. Gleichzeitig steht mit der eXtensible Markup Language (XML) eine erweiterbare Auszeichnungssprache zur Verfügung, die unter anderem als Quasi-Standard für den elektronischen Datenaustausch gilt. Um die Vorteile beider Technologien nutzen zu können, existiert bereits eine Reihe von Ansätzen, die eine Integration von XML und DBMS zum Ziel haben. Diese Ansätze erlauben es XML Datenbestände auf Basis deklarativer Abfragesprachen zu verarbeiten, jedoch wurde das Verändern von bestehenden Datenbeständen noch nicht genauer behandelt ([KIM02]). Ziel dieser Diplomarbeit ist es X-Ray QL, eine deklarative Abfrage- und Datenmanipulationssprache für X-Ray, ein Integrationsansatz unter Verwendung einer Metadatenbank, zu implementieren. X-Ray QL ermöglicht, neben dem deklarativen Erzeugen, Ändern und Löschen von XML Datenbeständen, auch einfache Abfragen durchzuführen. Durch die Implementierung von X-Ray QL entsteht der Laufzeitteil der X-Ray Architektur, welcher sich durch Sessionmanagement, Autorisierungsmechanismus und [¿]