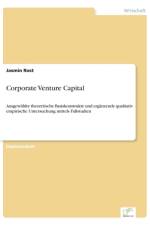- Ausgewahlte theoretische Basiskonstrukte und erganzende qualitativ empirische Untersuchung mittels Fallstudien
av Jasmin Rost
1 547
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: In dieser Arbeit werden etablierte Großunternehmen, die sich vorwiegend in der Reifephase befinden, nach den Motiven ihrer CVC-Engagements befragt, um so Aufschluss über die Hintergründe der CVC-Aktivitäten, in Zeiten großer Unsicherheiten und des Wandels, zu erhalten. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine qualitativ empirische Untersuchung, anhand von drei Fallstudien etablierter Unternehmen, die CVC schon über kurz oder lang betreiben. Mit Hilfe dieser Fallstudien und bereits vorhandener Literatur soll geklärt werden, warum etablierte Unternehmen das CVC-Konzept anwenden, welche Vorteile sie sich dadurch erhoffen und ob es einen Bezug zu den späteren Lebensphasen gibt, durch die eine Notwendigkeit von CVC-Aktivitäten resultiert. Aufgrund der Dynamik der Veränderungen, innerhalb und außerhalb des Unternehmens, wird deutlich, dass es permanenter strategischer und struktureller Anpassungen, sowie klarer Zielsetzungen, Strategien, Innovationen und einer intensiven Unterstützung des Managements über die Tagesfragen hinaus, bedarf. Gleichzeitig wächst der Innovationsdruck. Angesichts sich dramatisch verkürzender Innovations- und Lebenszyklen von Produkten sehen sich die Unternehmen vor der Herausforderung, mit knappen Budgets, sowohl das operative Geschäft zu finanzieren, als auch in die Zukunft zu investieren. Da besonders der Innovationsvorsprung in der Reifephase langsam verloren geht und damit auch die Gewinnmargen sinken, müssen neue Erfolgspotenziale, wie z. B. neue Technologien, generiert werden, um das etablierte Unternehmen zu revitalisieren. Eine effiziente und mit der Konzernstrategie kongruente Innovations- und Investitionsstrategie ist daher mehr denn je von Bedeutung. Strategischen Kooperationen mit jungen innovativen Start-ups, im Rahmen von CVC-Engagements, kommt daher eine Schlüsselrolle zu. Das CVC-Konzept kann durch die Kooperation Vorteile für etablierte und junge Unternehmen bringen. Tendenzielle Schwachstellen von jungen und etablierten Unternehmen können kompensiert werden, da beide Unternehmenstypen sich positiv ergänzen. Besonders durch direkte CVC-Beteiligungen, können Synergien gebildet werden, was zu einer win-win-Situation für beide Seiten führen kann. Auch wenn eine angemessene finanzielle Rendite ein wichtiger Baustein einer tragfähigen CVC-Strategie ist, rückt das Konzept des ?Value Adding? für Großkonzerne immer mehr in den Vordergrund, um Synergien aus der Kooperation zu nutzen. [¿]