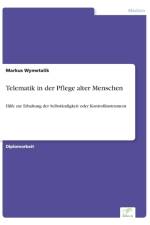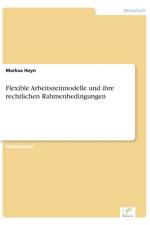- La mascherata, Gli indifferenti, Il conformista
av Michaela-Helga Schiebe
1 281
Inhaltsangabe:Einleitung: Viele geistesgeschichtliche, gesellschaftliche oder politische Strömungen finden ihren Nachhall in der bildenden Kunst und insbesondere der Literatur, denn sie gelten als die sichersten Ausdrucksmöglichkeiten eines Volkes. Kunst lebt immer von und mit der Gesellschaft, in der sie entsteht. Deren Produzenten versuchen deshalb oft in mehr oder minder starkem Maß bestimmte Einstellungen, Denkweisen, Zustände etc., zu reproduzieren und zu unterstützen - oder wollen sie mittels ihrer Werke kritisieren. Insbesondere Letzteres kann ein für den Künstler äußerst kompliziertes Unterfangen werden, nämlich dann, wenn Kritik nicht nur nicht erwünscht, sondern gar verboten ist und im Zweifelsfall auch verfolgt wird. Gerade diktatorische Systeme zeichnen sich durch die ausnahmslose und oft brutale Unterdrückung kritischen Gedankenguts aus. Der italienische Faschismus war ein solches System und in dieser Arbeit soll anhand dreier ausgewählter Werke - La mascherata, Gli indifferenti und Il conformista von Alberto Moravia - gezeigt werden, ob und mit welchen Mitteln es ihm gelungen ist, den italienischen Faschismus als politisches, gesellschaftliches und soziales Phänomen darzustellen und zu kritisieren. Der erste Abschnitt wird sich mit relevanten Aspekten der Biographie Alberto Moravias und seinem Oeuvre, sowie den Ursprüngen und wichtigsten Zeitabschnitten des faschistischen Regimes in Italien auseinandersetzten. Im zweiten Abschnitt sollen, nach einer kurzen Darstellung der verschiedenen literarischen Strömungen und Autoren dieser Epoche, einige charakteristische Merkmale des Faschismus in den genannten Werken nachgewiesen werden. Ein Vergleich mit Der Untertan von Heinrich Mann, der das Leben in einem ebensolchen und doch ganz anderen diktatorischen Regime beschreibt, wird die Arbeit abschließen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Alberto Moravia2 1.1Biographie2 1.2Oeuvre3 2.Der italienische Faschismus4 2.1Ursprung und Ideologie4 2.2Il ventennio nero7 2.2.1Machtübernahme und Etablierung des Systems7 2.2.2Konsolidierung der Macht9 2.2.3Expansion und Zerfall des Regimes10 2.3Das tägliche Leben12 2.4Presse und Zensur13 3.Faschismus und Literatur14 3.1Der Dekadentismus14 3.2Der Existentialismus15 3.3Der Realismus16 3.4Der Surrealismus17 4.Die Werke18 4.1La mascherata19 4.1.1Satire auf einen totalitären Staat19 4.1.1.1Polizei und Geheimdienst23 4.1.1.2Die 'innere Emigration'25 4.1.2Krieg und [¿]