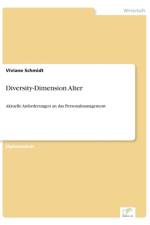- Eine Konzeption zur Pravention und Reduzierung
av Katinka Schmid
1 147
Inhaltsangabe:Problemstellung: In unserer heutigen schnelllebigen und stressbeladenen Zeit hört man zunehmend das Wort Mobbing, aber die Wenigsten wissen genau, was hinter diesem Wort steckt. Mobbing ? der Begriff ist noch relativ neu, das Phänomen existiert jedoch so lange wie die Arbeitswelt selber, ?denn unsoziale zwischenmenschliche Verhaltensweisen bis hin zu aggressivem Psychoterror gab es in den Betrieben schon immer.? Das bedeutet, dass wir zwar jetzt ein neues Wort haben, aber Feindseligkeiten, Willkür und Intrigen am Arbeitsplatz sind keineswegs neu. Neu ist allerdings, wie viele Menschen über diesen psychosozialen Stress bei der Arbeit klagen. Verfolgt man die Berichterstattungen in den Medien, scheint es, als ob Mobbing eine Volkskrankheit geworden sei. Es häufen sich Berichte von Betroffenen, die ihre Arbeitssituation als belastend oder sogar unerträglich erleben. Hier ist es schwierig, die Grenze zwischen normalen beruflichen und menschlichen Konflikten und Mobbing zu ziehen. Worin also besteht der Unterschied zwischen Mobbing und einem gewöhnlichen Konflikt? Der Konflikt wird meist unter gleich starken Partnern ausgetragen, beim Mobbing ist das Mobbing-Opfer deutlich unterlegen. Diese Unterlegenheit kristallisiert sich noch weiter heraus, da Mobbing ständig ausgeübt wird, der psychische Druck sich mit der Zeit steigert und weil Mobbing über einen langen Zeitraum stattfindet. Aufgrund des hohen Leistungsdrucks und der Verschärfung der Konkurrenz im Betrieb ist das Thema wieder besonders aktuell geworden. Diese Arbeit geht zunächst auf den Begriff Mobbing und seine Definitionen ein. Es werden danach die Symptome, d. h. wie lässt sich Mobbing überhaupt feststellen, die einzelnen Mobbing-Phasen und die 45 Mobbing-Handlungen behandelt. Anschließend wird detailliert auf die Ursachen von Mobbing eingegangen. Das dritte Kapitel zeigt die wirtschaftlichen sowie gesundheitlichen Folgen von Mobbing auf. Im vierten Kapitel werden ausführlich Maßnahmen zur Prävention und Reduzierung von Mobbing erläutert. Diese sind eingeteilt in Maßnahmen seitens des Mobbing-Opfers, des Arbeitgebers, des Betriebsrats, des Mobbing-Täters, des Vorgesetzten, der Kollegen, des Gesetzgebers und der Gesellschaft. Außerdem werden externe Hilfestellungen aufgezeigt. Um dem Titel der Arbeit gerecht zu werden, stellen die Ursachen für Mobbing und die Maßnahmen gegen Mobbing den Hauptteil der Arbeit dar. Es handelt sich bei dem Wort Mobbing um ein Kunstwort. Es [¿]