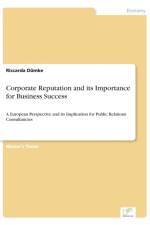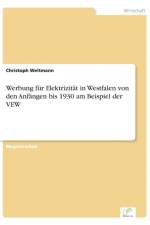- Ein neues Instrument kritisch betrachtet aus der Sicht betrieblicher Personalentwicklung
av Claudia Meyer
1 021
Inhaltsangabe:Einleitung: In Anbetracht der immer intensiver werdenden Diskussion über die Kosten der beruflichen Bildung einerseits und die Klagen über die Effizienz von Bildungsmaßnahmen sowie Motivationsschwierigkeiten andererseits, über den Trend zum arbeitsplatznahen Lernen und höhere Ansprüche an die Medien, angesichts kürzerer Produktlebenszyklen und schnell veraltender Wissensbestände, weltweiter Kommerzialisierung von Bildungsangeboten und nicht zuletzt eines immer schneller werdenden technischen Fortschritts, reichen traditionelle Wege der Weiterbildung nicht mehr aus. Die Unternehmen sind daher auf der Suche nach neuen Weiterbildungsmethoden, die ihnen eine zeitnahe und wirtschaftliche Lösung ihrer Qualifizierungsprobleme versprechen. Die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, deren Rekrutierung sich in den einzelbetrieblichen Entscheidungen zunächst als der schnellste, einfachste und günstigste Weg anbietet, sind nur noch in begrenztem Umfang zur Lösung der anstehenden Qualifizierungsprobleme tauglich. So sind in Zeiten rascher Innovationen und hoher Marktflexibilität entsprechend qualifizierte Fachkräfte, die umgehend einsetzbar sind, selten zu finden. Des weiteren sind die gewonnenen betrieblichen Erfahrungen der Beschäftigten für die weitere Qualifizierung von erheblicher Bedeutung, und es hat sich gezeigt, dass auf einem ständig steigenden Qualifikationsniveau eine zunehmende Qualifikationsdifferenzierung und -individualisierung erfolgt, die nicht mehr ohne weiteres kurzfristig über den Arbeitsmarkt substituierbar ist. Die Unternehmen sind daher darauf verwiesen, eher nach betrieblichen Lösungen ihres Weiterbildungsbedarfes zu suchen. Bei den konventionellen Weiterbildungsmethoden ist, abgesehen von der Ortsgebundenheit und Dauer, das Zahlenverhältnis von Dozenten und Lernern für die Kosten ausschlaggebend. Dieses Zahlenverhältnis lässt sich mit der Seminarmethode, die den Kern der traditionellen Weiterbildungsmaßnahmen bildet, nicht wesentlich verändern, wenn die angestrebten Lernziele auch erreicht werden sollen. Der Übergang zur Vortragsmethode, die dieses Zahlenverhältnis auflöst, ist nur zur begrenzten Informationsvermittlung geeignet. Beim herkömmlichen Fernunterricht mit Lehrbriefen und begleitendem Direktunterricht lässt sich das Betreuungsverhältnis vom Dozenten zu den Lernenden in begrenztem Rahmen erweitern. Bei dieser Variante werden jedoch die Lernzeiten zumindest teilweise in die Freizeit verlagert. [¿]