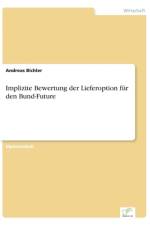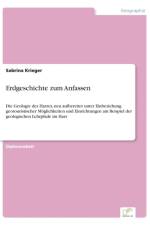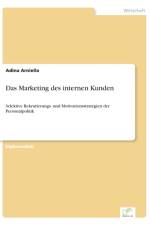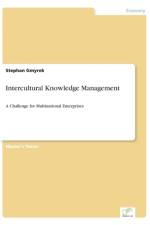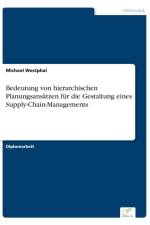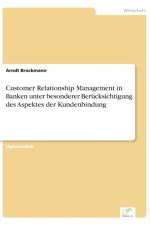- Ein Umnutzungskonzept ehemaliger Industriebauten zur Revitalisierung von Innenstadten
av Cassandra Muller
1 001
Inhaltsangabe:Einleitung: Folgende Ausgangssituation bot sich bei der Themenfindung dieser Arbeit: Erstens: Auf die Revitalisierung von Innenstädten ist derzeit der Fokus von Stadtplanern und -entwicklern gerichtet. Sie sollen belebt, ihr Leben und Wohnen attraktiver gestaltet werden. Zweitens: Anstatt das enorme Flächenpotenzial inmitten eines Stadtgefüges im Zuge einer Revitalisierung zu nutzen, stehen ehemalige Industriebauten leer. Ganze Industrieareale liegen brach. Drittens: Diese nicht wahrgenommene Ausschöpfung von Flächenpotenzial stellt sich zu Zeiten, in denen sich insbesondere vermarkten lässt, was sich individuelles und großzügiges Wohnen in Fabriketagen nennt. Die Rede ist von ?Loft Living? ? ein Umnutzungskonzept ehemaliger Industriebauten zur Revitalisierung von Innenstädten. Es stellt sich die Frage, ob sich die Umnutzung ehemaliger Industriebauten in die moderne Wohnform ?Loft Living? als ein Mittel zur Revitalisierung von Innenstädten eignet. Ziel dieser Arbeit ist es, die Ursachen des Warum in der technischen sowie wirtschaftlichen Realisierbarkeit suchend, aufzuzeigen, was technisch machbar und wirtschaftlich rentabel ist. Chancen und Risiken bzw. Anforderungen, die sich bei der Umnutzung ehemaliger Industriebauten in modernes, zeitgemäßes Wohnen ergeben, aus den unterschiedlichen Sichtweisen der einzelnen Beteiligten Gemeinde, Denkmalschutz, Planer und Architekten, Kapitalanleger und/oder Eigennutzer, Investoren sowie private Bauherrn zu durchleuchten. Wissenschaftlich ausgearbeitet sollen mit dieser Arbeit in einer Symbiose aus Immobilienwirtschaft, Baurecht, Technik und Architektur allgemeingültige Aussagen praxisorientiert aufbereitet werden. Abweichend von der überwiegend zu ?Loft Living? existierenden Literatur, soll diese Arbeit Hilfestellungen für die Praxis bieten und Lösungsansätze aufzeigen, als Handbuch mit aufklärendem Charakter rund um das ?Loft Living?. Voneinander abweichende Entwicklungsverläufe von Lofts in Deutschland gegenüber den Ländern USA und Großbritannien, richtet sich der Blick auf den hiesigen Immobilienmarkt. Deutschland als traditionelle Industrienation behandelnd, bezieht sich die Ausarbeitung im Schwerpunkt auf ehemals industriell genutzte Produktions- und Lagerhallen. Aufgrund ihres großzügigen Flächenangebotes werden sie als Orte vielseitiger und flexibler Nutzungsmöglichkeiten gegenüber anderen Gebäudetypen bevorzugt umgenutzt. Dem aktuellen Bestreben nach Steigerung von Wohn- und [¿]