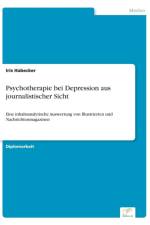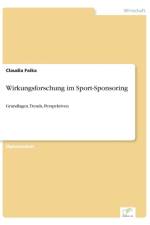av Sonja Dreier
1 047
Inhaltsangabe:Einleitung: Kaum ein betriebswirtschaftliches Instrument hat in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts einen derartigen Siegeszug vollzogen, wie dies für die Balanced Scorecard gilt. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Balanced Scorecard-Instrument bzw. haben es bereits eingeführt. Aufgrund dieser Aktualität widmet sich diese Arbeit der Thematik der Balanced Scorecard. Die genaue Themenstellung und Zielsetzung dieser Arbeit sowie deren Vorgehensweise wird im folgenden dargestellt. Unternehmen, die sich für die Einführung des Balanced Scorecard-Instruments entschieden haben, müssen, bevor sie mit der Umsetzung einer Balanced Scorecard beginnen können, diese zuerst einmal entwickeln. Da sich auch Global Foreign Trade dazu entschlossen hat, eine Balanced Scorecard einzuführen, beschäftigt sich diese Arbeit nicht mit der Umsetzung einer Balanced Scorecard, sondern mit deren Entwicklung. Thema dieser Arbeit ist also die Entwicklung einer Balanced Scorecard für Global Foreign Trade, HypoVereinsbank, Mailand. Da Schwierigkeiten, die bei der Balanced Scorecard auftreten, überwiegend auf unzureichende Gestaltungshinweise im Hinblick auf die Vorgehensweise bei der Entwicklung einer Balanced Scorecard zurückzuführen sind, ist es Ziel dieser Arbeit, gerade solche Gestaltungshinweise mit der Darstellung des Entwicklungsprozesses bei GFT zu geben. Es soll aufgezeigt werden, wie methodisch bei der Entwicklung vorgegangen werden kann, was es bei der Entwicklung zu beachten gilt, welche Probleme auftreten können und wie damit umgegangen werden kann. Der Prozeß der Entwicklung und nicht das Resultat steht dabei im Vordergrund. Zum einen, da die Erarbeitung einer Balanced Scorecard mindestens so wertvoll ist wie die resultierende Scorecard selbst, zum anderen, da die Ergebnisse von höchster Individualität gekennzeichnet sind und daher eine geringe, allgemeingültige Aussagefähigkeit bieten. Gang der Untersuchung: Um eine allgemeine, für die Arbeit notwendige Grundlage für ein besseres Verständnis für die Balanced Scorecard zu schaffen, wird im folgenden das Balanced Scorecard-Konzept kurz vorgestellt. Die Darstellung diverser Einsatzmöglichkeiten der Balanced Scorecard soll dabei veranschaulichen, wozu und wann die Balanced Scorecard überhaupt verwendet werden kann und, im speziellen Fall, warum sich GFT entschieden hat, die Balanced Scorecard einzusetzen. Im Anschluß daran werden verschiedene Ansätze hinsichtlich des Ablaufs der [¿]