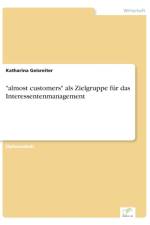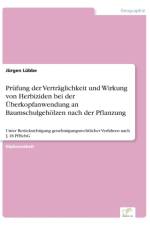av Katharina Geisreiter
1 021
Inhaltsangabe:Problemstellung: In Praxis und Wissenschaft ist es unbestritten, dass die Neukundengewinnung etwa um das vier- bis sechsfache teurer ist als die Bindung aktueller Kunden. Ein bestehender Kundenstamm verringert sich jedoch schon allein aufgrund natürlicher Fluktuation, wie beispielsweise durch einen Umzug oder einer Veränderung der Bedürfnisse der Kunden. Daher sollte die Neukundengewinnung nicht vollständig aus dem Fokus der Unternehmen verschwinden. Sie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die Zahl der Kunden konstant zu halten oder sogar auszubauen. Gerade weil die Akquisition neuer Kunden sehr kostspielig ist, ist es wichtig, diesen Prozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Es sollte eine möglichst große Anzahl der durch Marketingmaßnahmen gewonnenen Interessenten in tatsächliche Kunden verwandelt werden. Jedoch ist es praktisch nicht als realistisch anzusehen, dass alle Interessenten tatsächlich eine Kaufabsicht entwickeln. Daher ist es besonders wichtig, dass diejenigen, die sich zu einem Kauf entschlossen haben auch wirklich kaufen. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass selbst Interessenten mit einer Kaufabsicht sich noch am Point of Sale (POS) des Anbieters umentscheiden und unverrichteter Dinge wieder weggehen. Dieser Sinneswandel kann entweder durch verhaltenswissenschaftliche Gründe (wie etwa der Wahrnehmung bestimmter negativer Dinge) oder durch sonstige Probleme bei der Leistungserstellung zustande kommen. Personen mit einer festen Kaufabsicht, die schließlich doch nicht ausgeführt wird, bezeichnet man als ?almost customer? (AC). Durch diese AC entgehen den Unternehmen hohe Umsätze, die verhältnismäßig einfach in wirkliche Umsätze umgewandelt werden könnten, da der Hauptteil der Kundengewinnung bereits erfolgreich war, es fehlt ja nur an der Ausführung. Aus diesem Grund ist es für die Unternehmen besonders wichtig, Maßnahmen zu implementieren, die dabei helfen, das AC-Phänomen zu bekämpfen. Wenn ein Unternehmen dieses Problem erkannt hat, wird es vor der Frage stehen, in welche Abteilung die Zuständigkeit fällt. Die Verantwortlichkeit bemisst sich häufig danach, in welcher Phase des Kundenlebenszyklus diese eingreifen soll. Nachdem die AC die Kaufhandlung noch nicht wirksam abgeschlossen haben, wären die Aufgaben demnach dem Interessentenmanagement (IM) zuzuordnen, also dem Bereich im Unternehmen, der sich darum kümmert, Interessenten zu gewinnen, bei ihnen eine Kaufabsicht zu entwickeln und [¿]