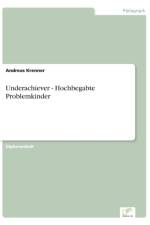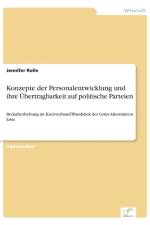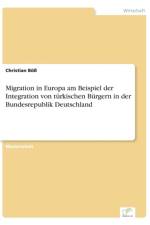av Christian Boess
1 667
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Migration der türkischen Bürger nach Deutschland hat mit den Anwerbevereinbarungen 1961 begonnen. Zunächst ging die Bundesregierung davon aus, dass die türkischen Arbeitsmigranten das Land wieder verlassen werden, wenn ihre Erwerbstätigkeit hier beendet ist. Jedoch zeigte sich im Zuge des Anwerbestopps von 1973, dass dies nicht der Fall ist, sondern die türkischen Bürger sogar ihre Familienangehörigen aus der Türkei nach Deutschland nachkommen ließen. Mit der Integration dieser Menschen hatte sich die Bundesregierung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht auseinandergesetzt, was zur Folge hatte, dass in Großstädten zunehmend Viertel entstanden, die vorwiegend von türkischen Bürgern bewohnt wurden. Die aktuelle Lebenssituation der türkischen Bürger in Deutschland, beschrieben durch die Bereiche Kindeserziehung, Sprachkompetenz, Bildung, Familienleben, Arbeitsmarkt, Wohnsituation, gesundheitliche Versorgung sowie Senioren, zeigt, dass sich im Laufe der Jahre deren Lebensumstände verbessert haben. Jedoch entsprechen sie nach wie vor nicht denen der deutschen Bürger oder denen anderer ausländischer Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die türkischen Bürger oftmals über nicht ausreichende deutsche Sprachkenntnisse sowie mangelnde (Schul-) Bildungsabschlüsse verfügen, die ihnen u. a. den Zugang zum Arbeitsmarkt erheblich erschweren. Durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene Aufenthaltsgesetz hat es sich die Politik zum ersten Mal zur Aufgabe gemacht, Zuwanderer aus dem Ausland, und damit auch türkische Bürger, in Deutschland zu integrieren. Dies soll zunächst durch eine gesetzlich vorgeschriebene Teilnahme an Integrationskursen erfolgen. In diesen bekommen die türkischen Bürger neben Kenntnissen der deutschen Sprache auch Wissen über die deutsche Geschichte, Kultur, Politik, Normen und Werte vermittelt. Neben diesem Kursangebot sollen zahlreiche weitere Integrationsmaßnahmen und Verbundprojekte auf Landes- und Kommunalebene dafür sorgen, dass sich die türkischen Bürger möglichst schnell in Deutschland eingliedern. Der am 14.07.2006 stattgefundene Integrationsgipfel zeigt aktuell, dass das Initiieren und Etablieren einer konstruktiven Einwanderer- und Integrationspolitik derzeit zu den Hauptaufgaben der Bundesregierung gehört. Ein möglicher EU-Beitritt der Türkei hätte dagegen zur Folge, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Integrationsmaßnahmen die türkischen Bürger nicht mehr [¿]