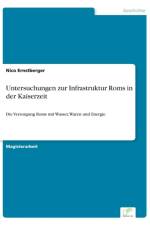- Chancen und Risiken, dargestellt an ausgewahlten Beispielen
av Melanie Sarah Etzold
2 477
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Marktgegebenheiten der Musikindustrie sind durch technologische Neuerungen und deren kommerziellen Einsatz einem drastischen Wandel unterzogen. Die Musikindustrie hat durch diese Neuerungen in Teilbereichen die Kontrolle über ihr Kerngeschäft, die Distribution und die Vermarktung von Musik, verloren. Die Struktur der globalen Marktteilnehmer verändert sich aufgrund dessen fortwährend, der Branchenzweig der Musikindustrie ist dabei, sich neu zu formieren. Resultierend aus vergangenen Entwicklungen kommt es zu massiven Umsatzrückgängen in der Musikindustrie, vor allem dadurch bedingt, dass es möglich geworden ist digitale Informationsgüter, wie Musik, ohne Qualitätsverlust zu vervielfältigen und durch das Internet kostenlos zu verbreiten. Dadurch drängen neue, nicht zu vernachlässigende Akteure in den Musikmarkt, die bestehende und künftige Marktsituation ist ungewiss. Vorliegender Arbeit soll aufzeigen, welche Marktentwicklungen bereits stattgefunden haben und wie der Markt für Musik und Musikprodukte reagierte. Zudem sollen anhand von bis dato erfolgreichen, neu entstandenen Vertriebsmodellen neuer Intermediäre im Musikmarkt Chancen und Risiken für die Musikindustrie identifiziert und beschrieben werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin zu zeigen, wie mögliche identifizierte Potenziale von den Hauptakteuren der Musikindustrie genutzt werden können, um weiterhin auf dem Zukunftsmarkt zu bestehen. Gang der Untersuchung: Im folgenden Kapitel vorliegender Arbeit wird die Musikindustrie mit wichtigen, auf dem Markt agierenden Hauptakteuren, vorgestellt. Die Besonderheiten der Musikbranche werden anhand der Wertschöpfungskette erläutert, ebenso wird auf das rechtliche Umfeld der Musikprodukte eingegangen. Zudem wird im selben Kapitel ein Überblick über die technologischen Neuerungen und deren Entwicklung gegeben. Im Bezug auf das Internet werden nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern ebenso wirtschaftliche Aspekte in die Betrachtung mit einbezogen. Im dritten Kapitel möchte ich die bisherigen Auswirkungen der technologischen Neuerungen auf die Musikindustrie erklären und welche Folgen für die Teilbereiche der Musikindustrie entstanden sind. Es wird dargestellt, welchen Einfluss die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Struktur und die Akteure in der Musikwirtschaft haben. Weiterhin wird gezeigt, welche möglichen Neuerungen existieren, die durch den technischen Fortschritt [¿]