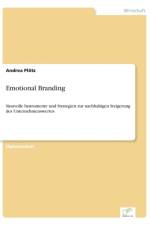- Eine medienpadagogische Auseinandersetzung mit den Massstaben und Kriterien der FSK
av Timo Uhlenbrock
1 211
Inhaltsangabe:Einleitung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehen gerne ins Kino und schauen sich gemeinsam Filme an, auch wenn die Besucherzahlen in den letzten 2 Jahren wieder gesunken sind. ?Besuchten 2002 noch 163,9 Mio. die deutschen Kinos, so waren es 2003 nur mehr 149,0 Mio...? Jedoch sei die Faszination ?Kino? laut Helmut Fiebig, Chefredakteur von ?CINEMA?, erhalten geblieben, denn ?Kino ist und bleibt das innovative Leitmedium zwischen Tradition und Moderne. Kino ist ein bodenständiges und bewahrendes Medium, das sich bislang in jeder noch so krisenhaften Situation behauptet hat ? und dies auch in Zukunft tun wird.? Und man muss dem amerikanischen Zukunftsforscher John Naisbitt Recht geben, wenn er sagt, dass man nicht nur ins Kino geht, um sich einen Film anzuschauen, sondern dass man sich vielmehr Filme im Kino anschaut, ?um mit zweihundert Menschen zu lachen und zu weinen.? Und gerade dieser ?Event-Charakter? ist es, weswegen Kinder und Jugendliche vorwiegend ins Kino gehen. Wenn Herr Naisbitt und Herr Fiebig Recht behalten sollen, so muss man sich auch in Zukunft um die Wirkung von Filmen, gerade in Bezug auf Gewaltdarstellungen, Gedanken machen. Denn ?unter allen Medienumgebungen ? wie man die zahlreichen Freizeitorte nennen kann, in denen Medien genutzt werden ? nimmt das Kino [gerade] für Jugendliche eine herausragende Stellung ein.? Für Kinder im Alter zwischen 6-12 Jahren spielt das Kino zwar noch eher eine untergeordnete Rolle, aber nichts desto trotz stellt es ein großes Unterhaltungsmedium dar. Und eine Elternumfrage (355 Elternfragebögen) aus dem Projekt der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), ?Medienkompetenz und Jugendschutz II ? Wie wirken Kinofilme auf Kinder?, hat gezeigt, dass 87 Prozent der Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren zum Zeitpunkt der Untersuchung schon mindestens einmal im Kino waren. In dieser Gruppe erfolgte dann der erste Kinobesuch zwischen drei und zehn Jahren. Und unter den Kindergartenkindern verfügten immerhin schon zwei Drittel über erste Kinoerfahrungen. Die Schülerbefragung bestätigte die Aussagen der Eltern. Demnach war die Hälfte der Kinder zum ersten Mal vor dem sechsten Lebensjahr im Kino. Diese Zahlen zeigen, dass auch jüngere Kinder zunehmend das Kino, zumeist zusammen mit ihren Eltern, für sich entdecken. Dabei sind die Altersstufen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JuSchG) noch nie grundlegend geändert worden und viele fordern eine [¿]