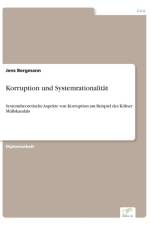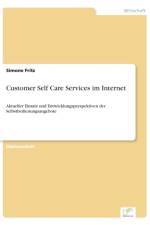- Ein Vergleich zwischen deutschen und spanischen Stadten hinsichtlich des kulturtouristischen Potenzials und der Vermarktungsmoeglichkeiten
av Ina Weber
1 337
Inhaltsangabe:Einleitung: Städte gelten als ein Spiegelbild dessen, was in Gesellschaften vor sich geht und entwickeln durch ökonomische, kulturelle und soziale Einflüsse eine individuelle Atmosphäre mit ganz eigenen Faktoren, die sie als vielseitiges Konstrukt attraktiv machen. So bietet jede Stadt ein eigenes Flair, was sie einzigartig und außergewöhnlich macht. Gerade kulturell lebendige Metropolen sind der Inbegriff der Modernisierung und bieten jedem Individuum Platz für Innovation, Kreativität, Inspiration und Abenteuer. Genau dieser spezielle Charakter trägt, vor allem in Europa, ein hohes Potenzial für das kulturtouristische Segment: ?In European cities, the unique architectural and cultural heritage of urban cores has been understood to be the main attraction for visitors; as a consequence, tourism development has been aimed at enhancing the character of each city.? So gehört besonders Städtetourismus zu einer wichtigen Ausprägung des Kulturtourismus. Oder, vice-versa, die kulturtouristischen Strömungen sind ein wichtiges Element im Städtetourismus. Neben musealen, historischen und traditionellen Monumenten werden auch Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten immer wichtiger, die durch die Städte selbst initiiert, den eigenen Standort attraktiver gestalten sollen. Die Suche nach Erlebnissen gehört heutzutage zu den wichtigsten Einflussfaktoren für die Reisemotivation und kann auch durch kulturtouristische Angebote bedient werden: ?War das kulturelle Interesse früher vor allem von Bildungsmotiven bestimmt, so besteht heute eher eine Freizeitkultur mit Schwerpunkten auf Unterhaltung, Geselligkeit und Erlebnis.? Ein Zauberwort für das attraktive Image einer Stadt ist deshalb Kultur. Neben Einkaufsmöglichkeiten, Veranstaltungen oder Erlebniscentern muss versucht werden, den städtischen Destinationen einen Mehrwert durch neue (und alte) ?kulturelle Angebote? zu schaffen und diese angemessen zu vermarkten. Kultur bzw. Kulturtourismus soll in der vorliegenden Arbeit als wertvolle Ressource zur Unterstützung des Städtetourismus untersucht werden. Verschiedene Vermarktungsmethoden sind dabei das wichtigste Instrument, um dieses Potenzial auszunutzen und zu reflektieren, denn ?Kulturproduktionen, die nicht vermarktet werden, stellen gewissermaßen eine nicht vollständig genützte Ressource dar, wenn das Potenzial der Vermarktung bestünde.? Methodisch verlangt dies vor allem eine konsequente Verfolgung der Marketingkonzepte. Doch wie kann das [¿]