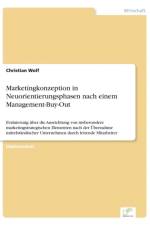av Pedro Americo De Souza
1 427
Inhaltsangabe:Einleitung: Der Eintritt einer Behinderung wird häufig mit Emotionszuständen wie Depression, Aggression, ungewisser Zukunft, Verzweiflung, Resignation, Schuldgefühlen, Abhängigkeit, einem niedrigen Selbstwertgefühl, verminderter Lebenszufriedenheit, dem Nicht-bewältigen-können der Behinderung und dem Abgeschrieben-Sein assoziiert. Wenn man jedoch Tetraplegiker bei einem Rollstuhlrugby-Spiel erlebt, entsteht nicht selten ein sehr positives Gefühl: ?Sie sind keine Invaliden, sie sind ja Kämpfer?! Anhand des Beispiels der Querschnittlähmung wird hier die neurologische, psychologische und soziale Lage des Betroffenen erläutert. Die Behinderungsverarbeitung ist seit geraumer Zeit ein wichtiges Bestreben, jedoch ist der Weg dorthin immer noch unbekannt. Wie können die Bewegungstherapeuten aus der Verzweiflung, aus der Resignation, aus der Ausweglosigkeit, usw., den Behinderten dazu verhelfen, sie zu ausgeglichenen, wieder aktiv an dem Gesellschaftsleben teilhabenden Menschen zu machen? Das Studium der Motivationspsychologie zeigt, dass es solch einen Weg bis heute immer noch nicht gibt. Die Motivationstheorie, trotz ihres großen Beitrags zum Verständnis und zur Förderung des Menschen, beantwortet immer noch nicht die Frage, wie die Therapeuten innerhalb der Bewegungstherapie und des Rehabilitationssports den Betroffenen bei der Überwindung solch schwieriger Lebenszustände helfen können. Unter Zuhilfenahme verschiedener Theorien liegt in dieser Abhandlung der Versuch vor, diese zur positiven Beeinflussung der Befindlichkeit und zur Behinderungsverarbeitung adäquat anzuwenden bzw. anzupassen. Damit wird erhofft, dass den Bewegungstherapeuten auf diese Weise eine theoretisch fundierte Basis zur positiven Förderung der Befindlichkeit und zur Behinderungsverarbeitung zur Verfügung gestellt werden kann. Unter solche Theorien fallen die ICF (?International Classification of Functioning, Disability and Health?) der WHO, das Spiralmodell zur Krisenverarbeitung als Lernprozess von Schuchardt sowie Aspekte der Motivationspsychologie. Die Bewegungstherapie und der Rehabilitationssport befassen sich mit Beeinträchtigungen des gesundheitlichen Zustands bzw. mit der körperlichen, psychischen und sozialen Integrität des Menschen und mit der Anwendung von Bewegung, Spiel und Sport als Mittel sowohl zur Prävention als auch zur Therapie bzw. als Rehabilitationsmaßnahme. Bewegungstherapie und Rehabilitationssport befassen sich meistens mit generellen [¿]

![Userfriendly Preparation and Presentation of Network Performance Data of Mobile Networks [GSM/GPRS/UMTS] af Sebastian Holzer](https://cdnbackdoor.tales.as/thumbnail/150x225/00070/77661/cover.1598574073.jpg)