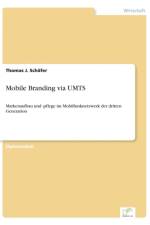- Entwicklung eines zukunftsorientierten Konzeptes mit Bildungschancen fur Eltern unter besonderer Berucksichtigung von Familien mit Migrationshintergrund
av Anke Boehme & Thomas Boehme
1 241
Inhaltsangabe:Einleitung: Über Elternpartizipation wurde in der Vergangenheit bereits viel geschrieben, doch ein spezifisches richtungweisendes Konzept zu deren Umsetzung in Kindertagesstätten, insbesondere unter Berücksichtigung von Familien nicht-deutscher Herkunft, fehlt bislang. Familien mit Migrationshintergrund liegen oft andere kulturelle Werte und Normen zugrunde und eine andere Familiensprache. Häufig haben die Eltern und zum Teil auch deren Kinder Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, fühlen sich alleingelassen und haben Berührungsängste, auch weil sie zum Teil schlechte Erfahrungen mit anderen Institutionen gemacht haben. Aus diesem Grund ist der kontinuierliche Kontakt zwischen ErzieherIn und Eltern und das Einbeziehen der Eltern in den Kindergartenalltag gerade bei Migrantenfamilien sehr wichtig. Um in der Gesellschaft zukünftig zurechtzukommen, müssen aber auch Eltern und Kinder der Dominanzgesellschaft lernen, mit Vielfalt umzugehen. In einer Zeit, in der Multikulturalität immer mehr Raum einnimmt, ist es wichtig, auf beiden Seiten die Angst vor dem Fremden zu nehmen. Daher ist das Einbinden aller Eltern in die Prozesse der Kindertageseinrichtung und ihre Fortbildung in Bezug auf Erziehungsfragen von hohem Stellenwert. Beispielsweise sieht Maaz einen Zusammenhang von autoritärer Erziehung und der Angst vor Fremden (latente Angst), die meist auf unbewusster Ebene abläuft. Wenn Kinder die Werte und Normen ihrer Gesellschaft nicht demokratisch verinnerlichen, erleben sie abweichende Normen und Werte anderer Kulturen als Bedrohung, da ihnen eine solche Abweichung früher verboten wurde. Im Extremfall kann daraus Fremdenfeindlichkeit entstehen. Die Zusammenarbeit mit Eltern ist daher sowohl ein wechselseitiger Lernprozess zwischen den ErzieherInnen und den Eltern, als auch zwischen den Eltern der verschiedenen Kulturen. Es wäre für eine Kindertagesstätte vorteilhaft, wenn sie ihre Arbeit transparenter gestaltet und neue kommunikative Formen der Eltern- und Familienarbeit entwickelt, sowie die Kooperation mit bzw. Integration von Sozialen Diensten, wie den Familien- und Erziehungsberatungsstellen, anstrebt. Denn die neuesten Forschungen belegen, dass es sich günstig auf die Entwicklung der Kinder auswirkt, wenn Eltern und Pädagogische Fachkräfte eng zusammenarbeiten. Daher gehen wir in dieser Arbeit von einer Kindertagesstätte aus, die als Lebensraum nicht nur für Kinder, sondern auch für deren Eltern bestimmt ist, mit der [¿]