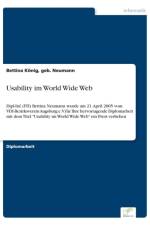- Eine kritische Untersuchung anhand deutscher, franzoesischer und englischsprachiger Medien
av Gabriele Brodmann
1 281
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Bewältigung der deutschen Vergangenheit ist ein Thema, das Menschen deutscher Nationalität seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr losgelassen hat. Bis heute noch wirft die Zeit von 1933 bis 1945 dunkle Schatten auf uns, die wir immer noch nicht wissen, wie mit dieser Bürde von damals heute umzugehen ist. ?Bewältigung? wird häufig gefordert ohne jedoch zu definieren, was damit gemeint sein könnte ? ?Verdrängung? ist wohl das, was man eigentlich wünscht, was auch in den letzten Jahrzehnten häufig so praktiziert wurde. Die Deutschen gehen verschwörerisch mit dem um, das ihre Geschichte, ihre nationale Identität und ihr Bild nach außen so nachhaltig veränderte. Verunsichert wohl auch, belastet durch eine Schuld, die heute nicht mehr ihre Schuld ist und dennoch weiterhin auf ihren Schultern lastet. Die unvorstellbaren Grauen des Nationalsozialismus haben in der Zeit danach eine Hilflosigkeit ausgelöst, die bis zum heutigen Tage anhält und in der Vergangenheit oft zu einer falschen Tabuisierung des Themas führte. Wie sollte man auch umgehen mit einer Schuld wie dieser? Wer sollte einem dafür jemals die Absolution erteilen? Wann durfte man zur ?Normalität? zurückkehren oder darf man es überhaupt jemals? Bis heute stehen wir vor diesem Problem, auch wenn viele es gerne übersehen oder verleugnen möchten. Spätestens wenn unser derzeitiger Bundespräsident Horst Köhler vor der Knesseth, dem israelischen Parlament, eine Rede halten soll, und es stellt sich die Frage, ob diese in deutscher Sprache, der Sprache des Tätervolkes, gehalten werden darf, kann man nicht mehr die Augen davor verschließen, dass die Zeit des Nationalsozialismus immer noch dunkle Schatten auf uns wirft. Horst Köhler hat meiner Meinung nach einen sehr klugen und sehr mutigen Weg gewählt, indem er die Abgeordneten des Parlamentes in hebräischer Sprache begrüßte und den Rest seiner Rede in Deutsch hielt. Bei der Begegnung unterschiedlicher Kulturen spielen Stereotype immer eine entscheidende Rolle ? keine positive, aber eine, die man nicht ignorieren kann. ?Bei der interkulturellen Begegnung tritt jeder Beteiligte seinem Partner mit vorgeprägten Vorstellungen und Einstellungen gegenüber. Fast immer sind bereits bestimmte Images, Einstellungen, Stereotype und Vorurteile vorhanden; und sie bestimmen im hohem Maße mit, wie im konkreten Fall die Prozesse der Interkulturellen Kommunikation und Interaktion verlaufen.? Wie Maletzke außerdem schreibt, [¿]