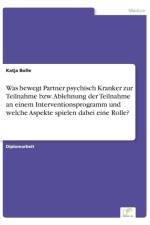- Eine Analyse speziell an Kinder gerichteter Werbespots
av Marion Landwehr
1 507
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Untersuchung behandelt: einmal die Werbung, die sich im Fernsehen gezielt an Kinder richtet und zum anderen die Darstellung von Kindern in den Werbespots. Bei ?Kindern? wird während der gesamten Arbeit von den 6-13jährigen ausgegangen, die Jugendlichen sind bewußt von der Untersuchung ausgeklammert. Bei der Werbung, die Kinder anspricht, handelt es sich meist um Produkte, die direkt die kindliche Sphäre betreffen: Das sind vor allem Süßigkeiten und Spielwaren. Gerade während des Kinderprogrammes werden solche Spots in einem so hohen Maße ausgestrahlt, daß ein Kind keine Möglichkeit hat, diesen Werbungen zu entgehen. Deswegen werden in dieser Arbeit die speziellen Programmschienen zweier Privatsender analysiert. In diesen Schienen werden täglich von sehr früh morgens bis in die frühen Abendstunden ohne Unterbrechung Zeichentrickserien und Cartoons ausgestrahlt. Verbunden werden die einzelnen Elemente mit Werbeeinblendungen, das heißt, wartet der junge Zuschauer auf die nächste Sendung, konsumiert er diese Spots mit (oder er schaltet so lange ein anderes Programm ein). Meist wird auch die Serie selbst unterbrochen, um Spots einzustreuen, nicht selten enthalten diese Werbungen während einer Zeichentrickserie auch Zeichentrickelemente. Inwieweit einem Kind bewußt ist, daß die Serie nicht weitergeht, sondern die Werbung das Sagen hat, ist eine Altersfrage. Es gibt viele verschiedene Ansichten darüber, ab welchem Lebensjahr ein Kind eindeutig unterscheiden kann zwischen Werbung und Programm. Relativ häufig wird allerdings von 8 Jahren ausgegangen, und erst mit zwölf Jahren ist ein Kind wirklich in der Lage, den Sinn und das Ziel der Werbung zu erkennen. Demgegenüber wird als Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender das Mittagsprogramm des ZDF untersucht. Auch hier kann man von einem Kinderprogramm ausgehen, das allerdings weitaus kürzer, aber abwechslungsreicher ist. Hier sind ebenfalls Werbespots plaziert und es soll festgestellt werden, wieviele davon sich an Kinder richten, ob es qualitativ bessere Spots sind und wie sie in das Programm eingebettet sind. Wichtig ist, wieviel Minuten Kinder heute vor dem Fernseher verbringen und davon ausgehend, wieviel Werbung sie dabei mitbekommen. Da Kinder für die Werbetreibenden eine sehr feste Zielgruppe sind, keine Gruppe so gut und sicher erreicht werden kann, wie die jüngsten Kinder im nachmittäglichen Programm, soll festgestellt werden, ob die Kinder hier nicht sogar [¿]