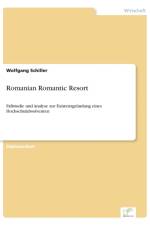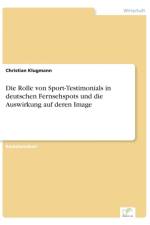- Unter besonderer Berucksichtigung aktueller rechtspolitischer UEberlegungen zum Kursbetrug
av Martin Le Vrang
1 281
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Geschönte Ad-hoc-Meldungen, unerfüllbare Gewinnprognosen, Verheimlichung unangenehmer Geschäftsentwicklungen vor den Aktionären und sogar die Bilanzierung frei erfundener Umsätze mit fiktiven Geschäftspartnern ? die Liste der Ungereimtheiten am Neuen Markt, die in den vergangenen Monaten ans Licht gebracht wurden, ist lang. Neu ist das Grundmuster dieser manipulativen Strategien indes nicht. Der Versuch, sich durch betrügerische Einwirkung auf den Börsenkurs einen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist beinahe so alt wie der Wertpapiermarkt selbst. Bereits kurz nach Gründung der Amsterdamer Börse im 17. Jahrhundert sollen Kursmanipulationen aufgetreten sein, und aus dem Jahre 1814 ist ein Fall überliefert, in welchem durch Verbreitung der Fehlinformation, Napoleon sei getötet worden, die Börsenkurse in England manipuliert wurden. Heute besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass manipulative Verhaltensweisen, die ein gezieltes Einwirken auf den Börsen- oder Marktpreis eines Handelgutes bewirken, das Vertrauen in den Kapitalmarkt beeinträchtigen und damit seiner Funktionsweise schaden können. Sie erzeugen Informationsungleichgewichte zwischen dem Manipulator, der die Hintergründe seiner Beeinflussung kennt, und anderen Marktakteuren, denen diese zusätzliche Information fehlt. So weiß ein Manipulator, der vorsätzlich eine falsche Information verbreitet, zunächst als einziger Marktteilnehmer von der Unrichtigkeit der Nachricht. Um Schaden vom Kapitalmarkt abzuwenden, müssen Wege gefunden werden, Kursmanipulationen zuverlässig zu vermeiden. Eine gegen Kursbetrug gerichtete gesetzliche Regelung ist umso mehr unabdingbar, als sich durch spektakuläre Fälle wie Enron und ComRoad gezeigt hat, dass auf das Urteil der Wirtschaftsprüfer nicht immer Verlass ist. Um eine effiziente Verfolgung zu ermöglichen und den Anlegerschutz zu stärken, wurde die Regulierung des Kursbetrugs in Deutschland mit dem Vierten Finanzmarktförderungsgesetz (4. FMFG) im Jahre 2002 reformiert. Der Verlauf des aktuellen Verfahrens gegen ehemalige Manager der EM.TV & Merchandising AG (im Folgenden: EM.TV) lässt allerdings Zweifel an der Wirksamkeit der Neuregelung aufkommen. Im Rahmen dieser Arbeit soll die straf- und zivilrechtliche Behandlung von Kursdelikten, insbesondere Kursbetrug, anhand eines Vergleichs der deutschen und der US-amerikanischen Rechtslage und der Implikationen aktueller rechtspolitischer Entwicklungen analysiert und kritisch [¿]