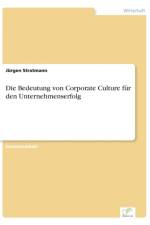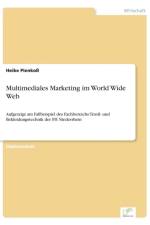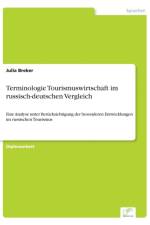av Jurgen Stratmann
837
Inhaltsangabe:Problemstellung: Folgt man der momentanen öffentlichen Diskussion, könnte man meinen, wirtschaftliche Erfolge sind nur zu erzielen, wenn es einem Unternehmen gelingt, möglichst viel Personal abzubauen oder die Produktion insgesamt ins Ausland zu verlagern, da dort die Löhne, insbesondere die Lohnnebenkosten, unter den hiesigen liegen. Es mehren sich jedoch die Stimmen, die diese Strategie nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch aus Sicht des einzelnen Unternehmens für bedenklich halten, sind es doch vornehmlich inländische Lohnempfänger, die die Produkte kaufen sollen. Daß sich die immer wiederkehrende Ankündigung, Mitarbeiter zu entlassen, nicht positiv auf die Arbeitsmoral und die Motivation, sich aktiv für das Unternehmen einzusetzen, auswirkt, liegt auf der Hand. Statt dessen erscheint es sinnvoller, der Frage nachzugehen, wie die Unternehmen mit ihrem gegebenen Potential am meisten erreichen können. Dies bedeutet, daß sich die Manager wieder mehr auf die eine gute Unternehmensführung kennzeichnenden Erfolgsfaktoren konzentrieren sollten. Ein seit den achtziger Jahren immer wieder genannter Erfolgsfaktor ist die Kultur eines Unternehmens. Sie soll im Zentrum dieser Arbeit stehen. Dabei wird sie aus einer funktionalen betriebswirtschaftlichen Perspektive gesehen. Andere wie bspw. ethnologische Aspekte spielen indessen keine Rolle. Gang der Untersuchung: Nach der Einordnung des Themas in die gegenwärtige politische Diskussion wird unter 2.1. aufgezeigt, wann ein Unternehmen als erfolgreich gilt. Unter 2.2. erfolgt der Versuch, den Begriff "Corporate Culture" zu definieren. Anschließend wird er von verwandten Begriffen abgegrenzt, bevor die der Unternehmenskultur zugeschriebenen Funktionen erläutert werden. Im Hauptteil werden drei Ansätze aus der Literatur, die sich mit unternehmensrelevanten Erfolgsfaktoren beschäftigen, präsentiert, um die Einordnung des Erfolgsfaktors "Unternehmenskultur" zu ermöglichen. Handelt es sich bei der Kultur um einen Erfolgsfaktor, steht die Unternehmensführung vor der Aufgabe, sich diesen zu Nutze zu machen. Das 4. Kapitel ist daher der erfolgsorientierten Gestaltung der Unternehmenskultur gewidmet. Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Wechselwirkungen zwischen Kultur, Strategie und Erfolg, die in Kapitel 5 behandelt werden. Bevor die Arbeit mit den Schlußbemerkungen und einem Ausblick endet, erfolgt in Kapitel 6 eine kritische Würdigung des Unternehmenskultur-Konzeptes, in der die sich durch [¿]