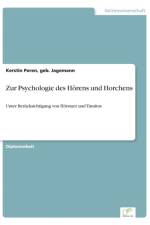- Unter Berucksichtigung von Hoersturz und Tinnitus
av Geb Jagemann Kerstin Peren
1 147
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist das "Hören". Dieser sehr unterschätzte Sinn erfährt bei genauerer Überlegung eine Aufwertung, indem er uns auch die Fähigkeit zu "Horchen" schenkt. Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedeutung zu untersuchen, die Hören und Horchen für den Menschen haben, und sich der Frage zu widmen, was geschieht, wenn uns dieser Sinn genommen wird. Um sich den Grundlagen des Gehörsinns zu nähern, wird im Kapitel I der physiologische Aspekt dieses filigranen Organs dargestellt. Onto- und phylogenetische Betrachtungen weisen diesem Sinn eine interessante entwicklungsgeschichtliche Rolle zu. Abschließend wird die physikalisch meßbare Topographie dieses Sinnes beschrieben. Die heutige Bedeutung des Hörens für die Psyche des Menschen zu verstehen, heißt, sich mit dem kulturgeschichtlichen 'Werdegangs' vertraut zu machen. Dies wird im Kapitel II zu finden sein. Sie soll auf einen Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Mißachtung und der jeweiligen kulturellen Gestimmtheit der Gesellschaft hinweisen. Das Verständnis des Hörens in der Geschichte der Psychologie wird anschließend dargestellt. Es soll deutlich werden, wie diese Wissenschaft das Hören untersuchte und wie sie das Horchen berücksichtigte. Hören meint hier nicht nur das rein physiologische Geschehen. Das eher beiläufige akustische Ereignis, das trotzdem den Menschen beeinflußt, ist mit Hören gemeint. Wir können unsere Ohren nicht schließen, uns dem Hören nicht verwehren. Es wird aus diesen Gründen in diesem Rahmen nicht ausschließlich als das Gegenteil von Horchen verstanden. Vielmehr ist Horchen auch die Erweiterung des Hörens. Horchen, und das wird im Kapitel III ausführlich beschrieben, ist kein zufälliges Geschehen, sondern an den Wunsch gekoppelt, horchen zu wollen. So meint Horchen eine "Haltung", eine "Einstellung", die je nachdem an das Sinnesorgan gebunden ist oder nicht. Geht es zum einen darum, den Wunsch zu verspüren, Geräusche oder Laute von außen durch das Ohr zu empfangen, geht es zum anderen darum, in sich selbst hinein zuhorchen. Die Anerkennung dieser Entfaltungsmöglichkeiten ist in der Arbeit von Alfred Tomatis wiederzufinden. Er beschreibt, was das Sinnesorgan Ohr und das Horchen für den Menschen bedeuten kann. Seine Erkenntnisse gehen weit über die vor ihm gültigen wissenschaftlichen Theorien und ihrem psychologischen Verständnis vom Hören als technische Funktion hinaus. So wird in [¿]