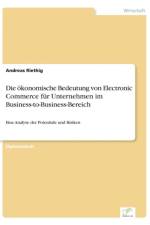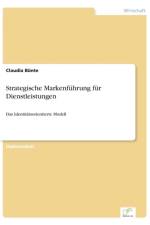av Simon Duckert
951
Inhaltsangabe:Einleitung: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Wissensmanagement aus technischer und sehr pragmatischer Sicht. Im Rahmen dieser Arbeit umfasst Wissensmanagement alle Anstrengungen, die unternommen werden, um Mitarbeiter mit dem Wissen zu versorgen, das sie benötigen, um für das Unternehmen mit optimaler Effizienz tätig zu sein. Das Ziel war, eine Plattform zu entwickeln, die im Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, im Folgenden IIS genannt, die Funktion eines Wissensmanagementsystems übernehmen kann. Nach Analyse der Ausgangssituation und der vorhandenen Wissensquellen musste zwischen der Implementierung auf einem kommerziellen System, auf einem OpenSourceSystem oder der Entwicklung einer neuen Plattform entschieden werden. Zunächst wurde die Eigenentwicklung fokussiert. Basierend auf dem Webserver Apache, der Skriptsprache PHP3, der Servletengine Jserv, der XMLRenderEngine Cocoon und der relationalen Datenbank mySQL wurde ein Prototyp erstellt. Es wurde erkannt, dass zu viel Zeit in die Entwicklung der Plattform investiert werden musste, die dann bei der Konzeption der WissensmanagementMethoden fehlte. Aus diesem Grund wurde die Eigenentwicklung eingestellt und der OpenSource Application Server ZOPE als Plattform herangezogen. Dieser eignet sich insbesondere durch seine offene Architektur, seine einfache Erweiterbarkeit und die umfassende Unterstützung von Standards (SQL, LDAP, FTP, HTTP, WebDAV, SOAP, XML, XMLRPC, RSS). Am Ende der Arbeit lag ein voll funktionsfähiger Prototyp vor, der zur Einführung von Wissensmanagement verwendet werden kann. Wichtig ist festzuhalten, dass diese Arbeit nicht als abgeschlossen gelten kann. Vielmehr müssen die Ansätze und Methoden in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess den Bedürfnissen angepasst werden. Nachdem alle benutzten Applikationen entweder OpenSource oder frei verfügbar sind, eignet sich dieses Konzept auch für kleiner Firmen oder Lehreinrichtungen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Executive Summary (Kurzfassung)7 Kurzfassung9 Vorwort10 Danksagungen10 Das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen10 Über dieses Dokument10 Konventionen13 1.Einleitung15 Themenstellung15 Was ist Wissensmanagement?15 Wissen15 Wissensmanagement17 Wissensmanagementsystem17 Einordnung dieser Diplomarbeit in einen Gesamtzusammenhang18 2.Vorüberlegungen20 Rahmenbedingungen am IIS20 Heterogenes (IT)Umfeld20 Vorhandene Plattformen20 Lotus [¿]