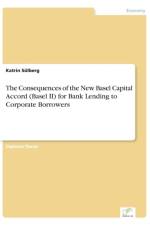- Eine Untersuchung von Pramissen und Ansatzen fur die Personalauswahl
av Marco Graf
1 281
Inhaltsangabe:Einleitung: Berichte über Fusionen und Markterweiterungen großer und mittelständischer Unternehmen sind heute an der Tagesordnung. Kein Unternehmen, das zu den ganz Großen gehören möchte, beschränkt sich auf nationale Anstrengungen in der Erweiterung der Geschäftsbereiche und Marktanteile. Die Globalisierung der Märkte wird so vorangetrieben. Dies zwingt viele Unternehmen, flexibler und dynamischer als bisher zu handeln ? durch ständig notwendige Produktinnovationen verkürzen sich die Produktlebenszyklen in der Konsumlandschaft fortwährend. Eine Konsequenz daraus ist, dass die Terminkoordination in den Unternehmen zunehmend schwieriger wird. Unternehmen, Abteilungen und Projektteams arbeiten immer weniger an einem Ort und in einer auf Dauer festen Formation zusammen, was häufig zu einem ?Meetingtourismus? von Führungskräften und ganzen Arbeitsgruppen führen kann. Ständig im Auto oder im Flugzeug befindlich, um Treffen in unterschiedlichen Ländern und Unternehmen wahrzunehmen, wird der Arbeiter so zum Tourist, der von einem Meeting zum nächsten eilt. Parallel dazu erreichte das Internet als ein neues Informationsmedium in den letzten Jahren geradezu explosionsartig wachsende Popularität - oft nicht so sehr wegen seiner Inhalte, sondern wegen des technisch Machbaren. Räumliche und organisatorische Grenzen lassen sich durch die so genannte Virtualität des Internets sehr leicht verschieben, wodurch eine ortsunabhängige Zusammenarbeit, wie z.B. in virtuellen Projektteams, ermöglicht wird. Diese Technologie schlägt eine Brücke über Raum und Zeit und ermöglicht neue Arbeits- und Organisationsstrukturen. So arbeiten heute in den Unternehmen nicht nur Menschen virtuell zusammen, sondern ganze Unternehmen werden virtuell organisiert. ?Die klassischen Grenzen der Unternehmung beginnen zu verschwimmen, sich nach innen wie nach außen zu verändern, teilweise aufzulösen.? Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand: ?Führungskräfte (...) haben nunmehr die Möglichkeit, Mitarbeiter nach ihrer Qualifikation und nicht nach geografischen Gesichtspunkten auszuwählen?(Picot et al., A., Die grenzenlose Unternehmung, 2003, S. 23) Problemstellung: Im Unterschied zur konventionellen Teamarbeit in Projekten werden bei virtueller Teamarbeit andere Anforderungen an die betroffenen Teammitglieder gestellt, die aufgrund der Virtualität hervorgerufen werden. Die Teamarbeit über räumliche Distanz hinweg beeinflusst sowohl die Arbeitsweise als auch die [¿]