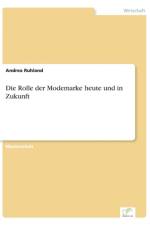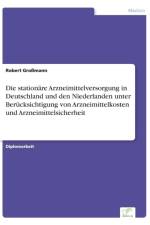- Am Beispiel von Teams und Jobpools
av Michael Faustmann
1 281
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Menschen sind in der Lage Verbindungen herzustellen, sind in der Lage assozia-tiv zu denken, können komplizierte Muster vervollständigen, können abstrahieren. Aus erlerntem Wissen, aus ungefähren Wahrnehmungen, aus Ideen, aus Inspirationen, aus Gedankenblitzen schaffen wir es Zusammenhänge zu erken-nen, Probleme zu lösen, Gedankengebäude zu entwickeln. Künstliche Neuronale Netzwerke (NN) sind in Aufbau und Funktionsweise dem menschlichen Gehirn nachgebildet. Sie lernen auf eine spezifische Art und Weise und haben, beispielsweise gegenüber Computern, ihre eigenen Stärken und Schwächen. Es können konkrete Aussagen darüber getroffen werden, welche Arten von Wissen und Fähigkeiten leicht erlernt werden können und welche Lernbedingungen für sie besonders günstig sind. Künstliche neuronale Netze werden in der Wirtschaft überwiegend für komplexe oder sich häufig wiederholende Aufgaben eingesetzt, die klassifizierenden oder beurteilenden Charakter haben. Anhand von weitgehenden Parallelen im Lernverhalten von biologischen und künstlichen neuronalen Netzen soll gezeigt werden, dass der Rückschluss auf menschliches Lernen durchaus zulässig ist und weiter, wie die über künstliche NN erlangten Erkenntnisse, in der betrieblichen Praxis angewen-det, Vorteile bringen könnten. Es geht zum einen um das Individuum:. Die unbewusste Kognition, das implizite Lernen und die vielleicht unterschätzte Bedeutung für die betriebliche Praxis. Zum anderen wird das Modell der NN auf die Informationsverarbeitung in sozialen Systemen, vornehmlich Gruppen, angewendet werden. Es wird gezeigt, wie und unter welchen Bedingungen Gruppen effizient arbeiten und wo sich Synergieeffekte verstecken. Der Hauptteil der Arbeit ist in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel erfolgt eine Einführung in Aufbau und Funktionsweise neuronaler Netze und es werden erste Analogien zwischen den Lernverhalten künstlicher und natürlicher neuronaler Netzwerke dargestellt. Das zweite Kapitel stellt die Brücke zwischen der Theorie und der Praxis dar. Das Modell der Neuronalen Netze wird im ersten, dem individuenzentrierten und im zweiten, dem gruppenzentrierten Abschnitt auf das jeweilige Subjekt angewendet. Dadurch entstehen neue Sichtweisen mit weitreichenden Konsequenzen. Empirische Studien und Beispiele aus der Praxis stützen die Darstellung. Im dritten Kapitel soll dann exemplarisch das Human Ressource Management als Anwendungsfeld dienen. Anhand der [¿]