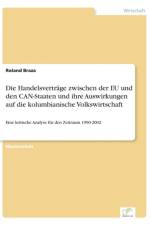- Inwieweit der Markenname die Produktbeurteilung beeinflusst
av Jana Geb Truschel
1 211
Inhaltsangabe:Einleitung: Coca-Cola, Nestlé, Levis, BMW etc. sind Marken, die sich keiner mehr aus unserer Gesellschaft wegdenken kann. Die Marke beherrscht unser alltägliches Leben mit solch einer Selbstverständlichkeit, dass sie oft synonym mit den Produktgattungen gebraucht wird, wie z. B. Tempo für Taschentuch oder Pril für Geschirrspülmittel. Vor allem im Nahrungs- und Genussmittelbereich ist die Auswahl an Produkten unterschiedlichster Anbieter mannigfaltig. Der Blick in den Supermarkt genügt. Obwohl die Unterschiede hinsichtlich der Qualität dieser Produkte oftmals gering sind, fällt die Wahl der Verbraucher eher auf Markenartikel, sofern die Preisspanne in einem akzeptablen Verhältnis bleibt. Der Grund für die Präferenz von Markenartikeln ist, dass der Mensch zwar essen und trinken muss, seine Nahrungswahl aber nicht bloß von den physiologischen Faktoren Hunger und Durst abhängt, sondern dass es um weit mehr geht: um Sicherheit, aber auch um Sehnsüchte, Glücksbegehren sowie Zugehörigkeit und Anderssein, so Bosshard in seinem Buch ?Die Zukunft des Konsums?. Er beobachtete, dass Essen und Trinken in gesättigten Märkten immer weniger mit den Produkten an sich zu tun haben, dafür immer mehr mit Medien, Marken und Kommunikation. Es findet eine Verschiebung von den hard facts zu den soft facts, vom Materiellen zum Immateriellen statt, so Sommer. Diese Verschiebung geht soweit, dass die Menschen nicht mehr auf ihre eigene Wahrnehmung hinsichtlich des Produkts hören, sondern sich nur auf die Marke und die Werbung der Marke und das vermeintlich ?bessere Lebensgefühl?, welches dort deklariert wird, verlassen. Ein gutes Beispiel stellt die Zigarettenwerbung dar. Hier wird der Konsum von Zigaretten sehr stark mit Freiheit verknüpft, obwohl eigentlich kein logischer Zusammenhang zwischen Zigaretten und Freiheit erkennbar ist ? bekanntlich begünstigt Rauchen Krankheiten und dadurch wird die Freiheit sogar vielmehr eingeschränkt. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen der Kenntnis eines Markennamens auf die Produktbeurteilung analysiert. Im Speziellen wird untersucht, inwieweit die Geschmacksbewertung vom Markennamen eines Produktes abhängig ist. Denn werden Konsumenten gefragt, warum sie beispielsweise Coca-Cola gegenüber einer anderen Colasorte bevorzugen, wird der Großteil wahrscheinlich antworten, weil sie ihnen besser schmeckt. Allerdings ist zu prüfen, ob es wirklich der Geschmack ist, oder ob nicht allein der Markenname Coca-Cola dafür [¿]