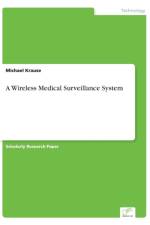av Mirja Lullic
1 361
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Mit der Menopause steigt die Inzidenz und Prävalenz kardiovaskulärer Erkrankungen erheblich an, was dazu führt, dass diese Erkrankungen die häufigste Todesursache postmenopausaler Frauen repräsentieren. Speziell die in der Postmenopause der Frau vermehrt auftretenden Lipidstoffwechselstörungen, gekennzeichnet durch quantitativ und qualitativ ungünstige Veränderungen, sowie die arterielle Hypertonie müssen therapeutisch konsequent angegangen werden. Körperliche Aktivität und Ernährungsumstellung spielen in der nicht-medikamentösen Prävention und Therapie der postmenopausalen Fettstoffwechselstörungen eine zentrale Rolle. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss einer kombinierten Intervention, bestehend aus Bewegungstherapie und Ernährungsumstellung, auf den Lipidstoffwechsel und das übrige kardiovaskuläre Risikoprofil zu untersuchen. Im Rahmen zweier Untersuchungsansätze (A und B) wurden unterschiedliche non-medikamentöse Interventionskonzepte evaluiert. Der Untersuchungsansatz A beinhaltete ein Programm, bestehend auf einer 8-wöchigen sporttherapeutisch überwachten Bewegungstherapie ohne Ernährungsintervention. Die Untersuchungsgruppe für diese Pilotstudie bestand aus 11 postmenopausalen Frauen (Alter: 57,36 ± 5,99 Jahre; Größe 1,67 ± 0,06 m; Gewicht 73,37 ± 7,69 kg; Körpermassenindex (BMI) 26,15 ± 2,78 kg/m²). Bei den Probandinnen wurden Stoffwechselparameter (Gesamt-Cholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Cholesterin/HDL-Quotient, Triglyceride, freie Fettsäuren, Glukose, Insulin, Leptin), Leistungsparameter (submaximale Leistungsfähigkeit bei 2mmol/l Blutlaktat, systolischer Blutdruck, Herzfrequenz und Laktat) sowie ein Fragebogen zur Lebensqualität vor und nach einem 8-wöchigen Ausdauertraining (dreimal 60 Minuten pro Woche, Walking und Fitness-Gymnastik) erfasst. Im Untersuchungsansatz B wurde bei einer Gruppe von 35 postmenopausalen Frauen (Alter: 59,86 ± 6,59 Jahre; Größe: 1,64 ± 0,06 m; Gewicht: 69,8 ± 11,36 kg; Körpermassenindex (BMI): 25,91 ± 3,78 kg/m²) eine Ernährungsintervention mit einem zusätzlichen Trainingsprogramm über 12 Wochen kombiniert. Zu Beginn des Trainingsprogramms befanden sich die Probandinnen bereits in der 5. Woche der Ernährungsumstellung und hatten zu diesem Zeitpunkt bereits im Durchschnitt 0,89 kg Körpergewicht abgenommen. Die Probandinnen durchliefen die gleiche Testbatterie wie in der Untersuchungsgruppe A. Nach der 4-wöchigen Ernährungsintervention absolvierten [¿]