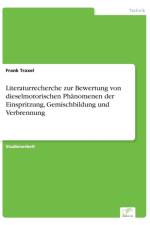- Eine inhaltliche und perspektivische Analyse von Vertrauen in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur
av Werner Sauer
1 281
Inhaltsangabe:Einleitung: In der modernen Unternehmensführung ist der Vertrauensaspekt bei den Kundenbeziehungen und bei den eigenen Mitarbeitern ein nicht mehr wegzudenkender Erfolgsfaktor geworden. In dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde eine Bestandsaufnahme zur Thematisierung von Vertrauen aus den aktuellsten wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen vorgenommen. Dabei geht es u.a. um die tatsächliche Implementation von Vertrauensmanagement in neuen bzw. schon bestehenden Organisationen aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen. Welchen direkten Nutzen hat ein Unternehmen von dieser Arbeit? Es werden zahlreiche Möglichkeiten des Vertrauensmanagements in traditionellen und neuen Organisationsformen gezeigt: z.B. die Automobilindustrie mit ihren Lieferanten, die gewichtige Bedeutung des Vertrauensmanagements im E-Commerce, Vertrauen in Öffentlichen Institutionen, etc. Aufgrund der transzendenten Eigenschaft des Vertrauensphänomens, wird nicht nur vertrauensvolles Handeln innerhalb einer Organisation untersucht, sondern auch die Kontakte außerhalb der Organisation, ihre unmittelbare Umwelt. Dabei werden häufig wichtige Kriterien beobachtet, die in vielen Publikationen empirisch nachgewiesen wurden, wie z.B. eine gesteigerte Effizienz, größere Arbeitszufriedenheit, sowie ökonomische Faktoren, die durch die Anwendung des Vertrauensmanagements deutlich verbessert wurden. Alle aufgeführten Publikationen sind Dissertationen, die sich mit diesem Thema sehr umfassend beschäftigt haben. Diese Diplomarbeit ist für Unternehmen als Anreiz, als Archiv der neuesten Publikationen in diesem Bereich und auch als Anleitung gedacht, Vertrauensmanagement in dem eigenen Organisationsbereich zu integrieren oder zu verbessern. Welchen Nutzen haben Studenten von dieser Arbeit? Für Studenten, die in den Bereichen der Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Personalführung, Organisation und Wirtschaftsinformatik sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzen müssen, werden immer wieder auf das Vertrauensphänomen stoßen. Für Laien ist allein die Erfassung des Vertrauensbegriffs ein kompliziertes Unterfangen, da dieser transzendent sich über alle Bereiche erstreckt, in dem menschliches Handeln vonnöten ist. Diese Bereiche können die Mikro-, Meso- und Makroebene umfassen, praktisch überall dort, wo die Anwendung oder die Ausführung menschlicher Aktivitäten vorkommt. Dabei werden bei der Analyse der Publikationen zum Vertrauensthema genau diese drei Ebenen [¿]