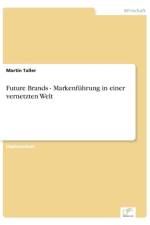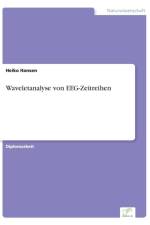av Silja Schroeder
1 281
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die in Deutschland immer bekannter werdende Form der Verkaufsförderung ? das Couponing ? gehört in den USA seit langem zu den wichtigsten Sales-Promotion-Instrumenten (Collard, Pustay, Roquilly & Zardkoohi, 2001; Rumler & Velte, 1987; Schultz, Robinson & Petrison, 1998; Shimp, 2000). Das Couponing bezeichnet den strategischen Einsatz von Coupons zu Marketing- und Vertriebszwecken. Als Coupons werden Wert- und Warengutscheine ? in den 70er Jahren als Rabattmarken bekannt (Spies, 2002) ? bezeichnet, die den Inhabern beim Erwerb bestimmter Produkte die auf den Coupons festgelegte Ersparnis ermöglichen (Bauer, Görtz & Dünnhaupt, 2002; Becker, Vering & Winkelmann, 2003; Fuchs & Unger, 1999). Die folgenden Angaben der Promotion Marketing Association mögen die immense Popularität dieses Instruments auf dem amerikanischen Markt verdeutlichen: Im Jahr 2000 wurden in den USA insgesamt 330 Milliarden Coupons verteilt. Von diesen wurden 4,5 Milliarden Stück mit einem Wert von über 3,6 Milliarden Dollar von den Konsumenten eingelöst (Bauer & Görtz, 2003). Verantwortlich für den verzögerten Einsatz von Coupons als Instrument der Verkaufsförderung in Deutschland war u. a. das bis zum 25. Juli 2001 gültige Rabattgesetz, nach dem Coupons starken rechtlichen Restriktionen unterlagen, die einen Einsatz nahezu unmöglich machten (Connor, 1999). Durch Coupons gewährte Preisnachlässe von mehr als 3 % des Endverbraucherpreises verstießen bis zu diesem Zeitpunkt laut Bundesgerichtshof (BGH) gegen § 1 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), in dem entsprechende wettbewerbliche Handlungen, die nicht mit den guten Sitten in Einklang gebracht werden können, untersagt werden. Die vom BGH verwendete Begrenzung auf 3 % resultierte aus dem Rabattgesetz (RabG), nach dem Barzahlungsrabatte nur bis zu diesem Prozentsatz zulässig waren. Aus diesem Grund wurden die 1970 von der Deutschen Unilever GmbH distribuierten Coupons für ein neues Waschmittel mit einen Wert von 10 % des Verkaufspreises vom BGH als unzulässig erklärt (Gedenk, 2002; Rumler & Velte, 1987; von Fragstein, 2002). Die Streichung der veralteten Reglementierungen war im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Handel im Internet zwingend notwendig geworden, da deutsche Unternehmen auf Coupon- und Rabatt-Aktionen von konkurrierenden Unternehmen mit ausländischem Firmensitz nicht angemessen reagieren konnten (Becker, Vering & Winkelmann, 2003; von Fragstein, 2002). Ob Coupons in [¿]