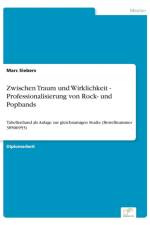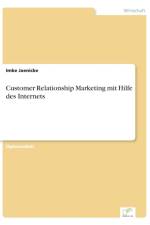- Fallstudie uber die Situation von Prostituierten und den Umgang mit der Prostitution
av Nadine Rebel
1 951
Inhaltsangabe:Einleitung: Kaum ein Gewerbe konnte sich über so lange Zeit und über alle Krisen hinweg halten wie die Prostitution. Aber auch kaum ein Gewerbe, das einen nicht zu vernachlässigenden Erfolg zu verzeichnen hat, ist von der Gesellschaft derart geschmäht. Gerade heute, in Zeiten von sexueller Präsens allerorts, mutet der ambivalente Umgang mit dem ?ältesten Gewerbe der Welt? seltsam an. Die Prostitution und die Damen und Herren, die dieses Gewerbe ausüben, beziehungsweise in Anspruch nehmen, dienten unzähligen Büchern aller Genres, von wissenschaftlich bis belletristisch, als Vorlage und Material. Immer wieder wurde auf allen Wegen versucht, herauszufinden, warum Frauen ihre Körper verkaufen und was Männer dazu bewegt, sich die Illusion von Liebe und Zuneigung zu erkaufen. Auch das Fernsehen, füllt seine Abendprogramme nach 22:00 Uhr ständig mit dem voyeuristischen Blick ins Milieu, streng getarnt unter dem Deckmantel objektiver und wissenschaftlicher Reportagen. Es wird einen Glauben gemacht, die Prostitution und die Damen, die diesem Beruf nachgehen, seien ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, der nun endlich auch als ein solcher akzeptiert werde. In der Bevölkerung mag dies sogar der Fall sein. Solange man selbst nicht tangiert wird, ist es dem einzelnen prinzipiell tatsächlich egal, welchen Beruf eine Dame ausübt. Manchmal geht die Akzeptanz sogar weiter und endet in wahrer Toleranz. Sieht man sich die Entwicklung des Umganges mit der Prostitution an, so muss man allerdings sehr bald feststellen, dass der größeren Toleranz der Bevölkerung eine veraltete und keineswegs tolerante Umgangsweise der Behörden gegenübersteht. Eine Dame, die offiziell der Prostitution nachgeht, dies vielleicht sogar als Haupttätigkeit ausführt, hat eine Unmenge von Pflichten gegenüber den Behörden zu erfüllen und kann kaum Rechte nutzen. Steuern darf eine Prostituierte zahlen, weil sie ein ?normales? Gewerbe ausübt, das dazugehörende Gewerberecht, darf die Dame allerdings nicht in Anspruch nehmen, da sie es aufgrund der Sittenwidrigkeit ihrer Tätigkeit nicht nutzen darf, dies sei nur ein Beispiel. Die Notwendigkeit der Existenz der Prostitution wird zwar eingesehen und das Überdauern vieler Jahrhunderte und Jahrtausende zeigt auch, dass der Bedarf immer da war und immer da sein wird, dennoch ist es verwunderlich, dass man eigentlich nie einen Kunden, einen Gast oder Freier findet, der offen zugibt, die Dienste der Damen zu nutzen. Die [¿]