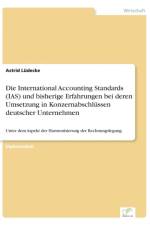av Yesim Akbaba
2 477
Inhaltsangabe:Einleitung: ?Irren ist menschlich? sagt eine alte Weisheit und lässt die Forderung nach einem Null-Fehler-Standard zunächst etwas illusorisch erscheinen. Den meisten Menschen widerstrebt es, Null-Fehler als Standard für die eigene Arbeit zu akzeptieren. Viele glauben, Fehler seien unvermeidlich. Menschen akzeptieren Fehler nicht nur, sie sehen sie sogar voraus. Es macht wenig aus, bei der Arbeit gelegentlich mal einen Fehler durchgehen zu lassen. Vielleicht einmal, weil man daran glaubt, dass es irgendjemanden gibt, der diesen Fehler schon beseitigen wird, zum anderen, weil man davon ausgeht, dass das Management eine gewisse Anzahl von Fehlern sowieso eingeplant hat. Im privaten Leben akzeptieren man Fehler viel weniger. Man geht davon aus, dass im Konzertsaal die Musik ohne falsche Töne und in vollendeter Interpretation dargeboten wird, dass die Bank die Zinsen für das Konto korrekt berechnet und dass die Bremse des Autos bei 1000 Bremsungen 1000-mal funktioniert. Es gibt also offensichtlich eine Diskrepanz zwischen dem, was man erwartet, und dem, was man selbst zu realisieren bereit ist. Versetzt man sich in die Lage des Kunden, so müsste man die Forderung nach einem Null-Fehler-Standard auch für die eigene Arbeit akzeptieren. An dieser Stelle mag eingewendet werden, dass es in manchen Fällen wirtschaftlich unsinnig sein kann, Null-Fehler als Qualitätsziel anzustreben, nämlich immer dann, wenn die Kosten für die Vermeidung und Beseitigung von Fehlern ins Unendliche wachsen, sobald man sich der Null-Fehler-Grenze nähert. Diese Überlegung hatte zum Prinzip der ?zulässigen Fehlerrate? (Acceptable Quality Level, AQL) geführt. Die zulässige Fehlerrate mag in diesen Fällen durchaus als Qualitätsziel akzeptabel sein, sie muss aber laufend überprüft und in Frage gestellt werden. Allzu oft wird die zulässige Fehlerrate nur als Entschuldigung benutzt, wenn ein durchaus realisierbares Null-Fehler-Ziel nicht erreicht wurde. Null-Fehler ist ein erreichbares Ziel. Das wird in den folgenden Seiten genau erläutert und mit vielen praktischen Beispielen deutlich dargestellt (siehe Anhang 1). Das Null-Fehler-Prinzip muss die Einstellung der Menschen zum Fehler verändern. Ein Fehler darf nicht einfach mehr hingenommen werden als notwendige, allein schon durch die Statistik erklärbare Erscheinung, sondern muss als Indiz für ein Versagen im Arbeitsprozess verstanden werden und gleichzeitig als eine Chance, die Ursache dieses Versagens endgültig zu [¿]