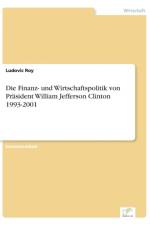- Kulturelle Identitat, Protest, Abschottung, selbstinszenatorischer Erfindungsreichtum und seine Vermarktung
av Karsten Wolff
1 001
Inhaltsangabe:Einleitung: In Berlin hat sich seit dem Mauerfall eine neue Jugendkultur etabliert, die allgemein als Technoszene bezeichnet wird. Diese deutschlandweite Jugendbewegung entwickelte sich auf besondere Art und Weise; dazu weiter unten mehr. Von hier gingen und gehen weiterhin wichtige trendsetzende Impulse aus, was Musik, Mode, Parties und die besondere Clubszene ?made in Berlin? betrifft. Zudem wird in Berlin das Kulturgut der Technoszene heute von jenen professionell vermarktet, die seit den ersten Technoparties mit dabei waren und, als die Vorreiter von damals, heute große Teile des Erlebnismarktes um die Technokultur mit ihren Ereignissen und Produkten bedienen; sie kommen weiter unten zu Wort. In Berlin liegen Szenekreativität, der Spaß an der Kultur und das harte Vermarktungsgeschäft sehr nah beisammen. In der Technoszene manifestieren sich zudem der Zeitgeist, der Kultur- und Wertewandel seiner 16-29jährigen Zielgruppe deutlich im metropolitanen Geschehen, vollzieht man die neuen Ausdrucksformen nach und ordnet man sie in den gesellschaftlichen Kontext ein. Die Extension der Technoszene ist international. Ihre Mitglieder kommunizieren weltweit miteinander. Parties, Musik, Mode, Lebensstil, Kunst und Gedankengut aus Berlin befruchten sich und korrespondieren mit vergleichbaren Kreativprodukten Gleichgesinnter aus New York, London, Detroit oder Stockholm. Berlin ist wichtige Schnittstelle eines globalen ?Techno-Undergrounds?. Stilprägendes und identitätsstiftendes Element im Techno-Underground ist das Rebellorische. Aus Sicht der Konsumenten rebelliert Technokultur eben durch ihre Inkonsumerabilität. Das klingt paradox, vergegenwärtigt man sich die gigantischen Ausmaße des Konsums von Techno-Produkten, muß sie eher als Denkrichtung interpretiert werden. Es gehört zum persönlichen Stil der Technokonsumenten, möglichst neue, noch nicht als Massenware geltende Technoprodukte zu konsumieren. Techno, so seine ursprüngliche Idee, sollte eben nicht von der alles verschlingenden Unterhaltungsindustrie kopiert werden können. Teile der Szene sind permanent damit beschäftigt, Neues zu schaffen, was wenigstens eine bestimmte Zeit lang nicht industriell kopiert werden kann. Das Unbehagen im Techno-Underground, als gewöhnliche Mainstream-Kultur adaptiert zu werden, zwingt seine kreativen Innovationskräfte zu Trend- und Zeichenerneuerungen innerhalb der Kultur in bisher nie gekannter Schnelligkeit. Nur durch die permanent wechselnden [¿]