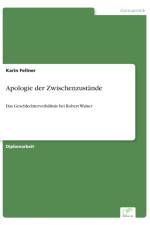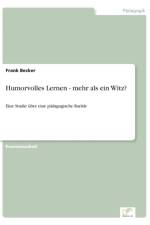- Auswirkungen sowie Praventions- und Interventionsmoeglichkeiten, auch anhand von Erfahrungsberichten betroffener Frauen
av Tanja Jung
1 147
Inhaltsangabe:Einleitung: Sexueller Missbrauch ist ein Thema, das für viele Menschen ein Tabu darstellt; doch nicht der Missbrauch an sich unterliegt diesem Tabu, sondern das Sprechen darüber. So findet sexuelle Ausbeutung auch nicht erst seit heute statt, sondern hat eine jahrhundertealte Tradition. Doch erst zu Beginn der 80er Jahre rückte das Thema immer mehr in den Vordergrund. Dies ist ein Verdienst der Frauenbewegung, denn zu dieser Zeit gingen erstmals betroffene Frauen an die Öffentlichkeit und berichteten von ihren schrecklichen Kindheitserfahrungen. Der sexuelle Missbrauch findet in überwiegender Zahl in der eigenen Familie statt und kann für die Opfer eine Vielzahl von Folgen in den verschiedensten Lebensbereichen mit sich bringen. Ich begann mich zum ersten Mal näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als ich die gravierenden Auswirkungen des Missbrauchs bei einer Freundin ?miterleben? durfte und daraufhin beschloss, mir im Rahmen meiner Diplomarbeit weitere Informationen darüber zu erarbeiten. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die große Bandbreite der Auswirkungen und Folgen des Missbrauchs für die Betroffenen herauszustellen. Es soll aufgezeigt werden, was dieses Trauma für die Opfer bedeuten kann, auch wenn es sich jeweils um individuell unterschiedliche Auswirkungen und Schweregrade der Folgen handelt. Des Weiteren zielt sie darauf ab, Möglichkeiten der Prävention und Intervention aufzuzeigen, welche dazu beitragen, dieses Verbrechen zu verhindern bzw. frühzeitig zu beenden, um die gravierenden Folgen für die Opfer zu minimieren. Die vorliegenden Ausarbeitungen geben vorab einen Überblick über das Thema des sexuellen Missbrauchs, indem zunächst eine Definition sowie die begriffliche Abgrenzung zu anderen, in der Literatur verwendeten Begriffen erfolgt und verschiedene Formen des Missbrauchs erläutert werden. Ebenso werden die Phasen, nach denen der Missbrauch in den überwiegenden Fällen verläuft, geschildert und die Machtstellung des Täters wird näher erläutert, um zu verdeutlichen, um welche Art von Vergehen es sich handelt. Gang der Untersuchung: Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs für die Opfer, sowie den Präventions-, Interventions- und Hilfemöglichkeiten, welche zur Verfügung stehen, um dem Missbrauch vorzubeugen bzw. den Betroffenen Unterstützung anzubieten. JÖNSSON (1997) unterscheidet in Bezug auf die Auswirkungen der sexuellen Übergriffe, zwischen dem direkten [¿]