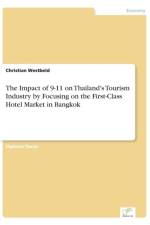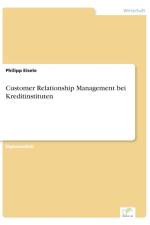av Karin Gerstner
1 241
Inhaltsangabe:Einleitung: Im Rahmen dieser Diplomarbeit ist es mir ein Anliegen herauszustellen, welche Hilfemöglichkeiten für Scheidungskinder angeboten werden, denn auch diese haben Bedürfnisse, Ansprüche und Wünsche, bezüglich der elterlichen Trennung und Scheidung. Edelgard Placke- Brüggemann hat diese Wünsche zusammengefasst, z.B.: ?Redet mit mir. Ich kriege schon seit längerer Zeit mit, dass etwas in unserer Familie nicht stimmt. Wenn ihr nicht mit mir redet, wachsen meine Fantasien ins Unerträgliche.?. ?Sagt mir ausdrücklich, dass ich keine Schuld an der Trennung habe, auch wenn ich mitbekommen habe, dass ihr euch oft über meine Erziehung gestritten habt.?. ?Haltet meine Wut, meine Angst, meine Stimmungsschwankungen aus, so versuche ich meine Konflikte zu bewältigen.?. ?Helft mir zu sehen, dass mit der Trennung endlich der Streit zu Hause aufhören kann, dass dies auch eine Chance für einen Neubeginn darstellt.?. Die Kinder sind das schwächste Glied in der Kette der Betroffenen. Gerade deshalb benötigen sie Hilfe und Unterstützung, damit die elterlichen Konflikte, sowie die Trennung/ Scheidung für sie nicht zu einer lebenslangen Belastung werden. Die Ergebnisse der Scheidungsforschung, welche sich mit der Dynamik des Scheidungsprozesses und den Folgen für alle Beteiligten befassen, geben Hinweise für den Umgang mit Scheidungsfamilien. Desweiteren berücksichtigen die Fachkräfte der Institutionen, welche Maßnahmen für Scheidungsfamilien anbieten, diese Ergebnisse. So bemühen sich z. B. Familiengerichte, Jugendämter, Beratungsstellen, Anwälte, Psychologen und Sozialarbeiter, den betroffenen Kindern und den Eltern gerecht zu werden. Mit der Einführung des neuen Kindschaftsrechts vom 1.7.1998 veränderten sich einige Bedingungen für die Betroffenen. So wird z. B. deutlich herausgestellt, dass das Kind ein Recht auf Umgang mit beiden Eltern auch nach einer Trennung/ Scheidung hat. Desweiteren besitzen Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Inwieweit sich diese neuen Bedingungen deeskalierend auf die streitenden Eltern auswirken, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Die positive Wirkung des Gesetzes hängt mit der Umsetzung in die Praxis und der gelingenden Kooperation aller Institutionen, die in die Arbeit mit Scheidungsfamilien eingebunden sind, zusammen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht, wie bereits erwähnt, die bestehenden Hilfeangebote für Scheidungskinder unter Berücksichtigung [¿]