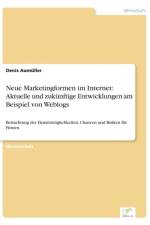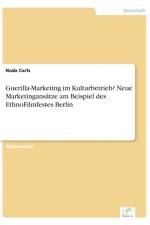- Unter Berucksichtigung der Produkt- und Markenpiraterie
av Nicole Ruppel
1 547
Inhaltsangabe:Einleitung: Wir leben in einem globalen Markt. Die Globalisierung bekommen wir alle zu spüren. Das fängt schon beim täglichen Frühstück an. Kaffee, Tee, Orangensaft, alles Produkte, die aus Afrika, Lateinamerika oder Asien zu uns gelangen. Wir besitzen Möbelstücke von Ikea, dem weltweit tätigen Unternehmen aus Schweden. Unsere Garderobe ist global, denn 45 % der Kleider, die über deutsche Ladentische gehen, werden in Asien, Osteuropa und Mittelamerika genäht. Der Computer auf unseren Schreibtischen ist entweder ein preisgünstiger PC-Klon aus Taiwan oder aber auch ein in den USA entwickelter und in Irland gefertigter Apple Macintosh. In unserem CD-Ständer finden wir die neueste CD der Wiener Philharmoniker, die in der New Yorker Met unter einem italienischen Dirigenten das Werk eines russischen Komponisten spielen. Die Uhr an unserem Handgelenk: Made in Japan, Hongkong, Singapur, Schweiz. Mit großer Selbstverständlichkeit hat sich eine globale Arbeitsteilung etabliert, die es bspw. einem koreanischen Autohersteller erlaubt, sich bei der Entwicklung eines neuen Autos die Finanzierung aus Japan, das Design aus Italien und Motor und Getriebe aus Deutschland zu holen. Zusammengebaut wird der Wagen in England mit lohnintensiven Schlüsselkomponenten aus Korea und elektronischen Einrichtungen, die in den USA entwickelt und in Taiwan produziert werden. Mit solchen Beispielen wird deutlich, wie sehr die Globalisierung den Alltag in unserem Land prägt. Die Welt hat sich in ein globales Dorf verwandelt. Während vor 20 Jahren das Konzept des globalen Marketings nicht einmal existierte, hat es jetzt einen festen Stellenwert in Unternehmen von heute. Vor dem Hintergrund einer aktuell stagnierenden Binnenwirtschaft in Deutschland und den zumeist gesättigten westlichen Märkten wird es für nationale und internationale Unternehmen zunehmend schwieriger, ihre Produkte abzusetzen und Gewinne zu realisieren. Aus diesem Grund erkennen heutzutage immer mehr Unternehmen, dass sich der Wettbewerb aufgrund der Internationalisierung der Märkte und den damit einhergehenden Veränderungen, wie die Öffnung Osteuropas und der Abbau von Handelsbarrieren in fast allen Kontinenten, nachhaltig verstärkt. Eben durch diese zunehmende Konkurrenz, einem hohen Kostendruck und der steigenden Marktsättigung wird nach einer strategischen Ausrichtung der Unternehmen auf den Auslandsmärkten verlangt. Der entscheidende Grund, warum also Unternehmen globale [¿]