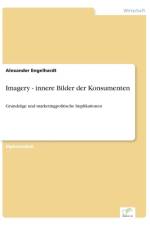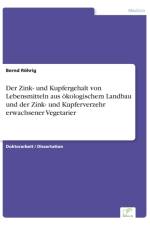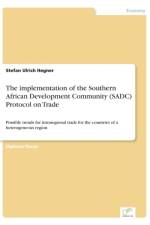- Dargestellt am Beispiel des Biermarktes
av Ralf Kaufmann
951
Inhaltsangabe:Problemstellung: Der deutsche Biermarkt ist durch seine atomistische Struktur ein äußerst schwieriger und hart umkämpfter Markt. Jeder kämpft gegen jeden. Handel gegen Produktion, Kleine gegen Große, Große gegen Kleine, Große gegen Große. Der Pro-Kopf-Verbrauch nimmt seit Jahren ab und ständig drängen neue Produkte auf den Markt: Schwarze Biere, gemixte Biere, Saisonbiere, Fußballbiere, Karnevalsbiere, Biere, die nur zu einer bestimmten Tageszeit gebraut werden etc. Mit verstärkten Sponsoringaktivitäten, aufwendigen Kampagnen und nicht zuletzt mit Neustrukturierungen in der Management-Organisation versuchen Große und Kleine ihre Position auf dem Biermarkt zu behaupten. Über 5000 Biermarken und 1200 Brauereien teilen sich den Biermarkt in Deutschland. Das Mediavolumen beträgt 850 Mio. DM, wobei die Hälfte davon auf lediglich 12 Marken entfällt. Die Fernsehbiere werben mit einem gewaltigen finanziellen Einsatz und versuchen, die Marktanteile der regionalen Brauereien zu übernehmen. Unterstützt werden sie von der nachlassenden Markentreue der jüngeren Verbraucher im Bierbereich. Die regionalen Brauereien müssen alles daran setzen, ihre Kunden und damit ihre Marktanteile in diesem Verdrängungswettbewerb zu halten. Dazu sind aber neue Konzepte und Strategien notwendig, die sich von denen der nationalen und regionalen Konkurrenz unterscheiden. Zu lange waren Tradition, Heimat und Frische die einzigen Begriffe, mit denen eine regionale Biermarke für sich warb. Es gilt ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen. Eine regionale Biermarke darf sich nicht zu sehr in die traditionelle Ecke begeben, besonders dann nicht, wenn sie jüngere Leute als Zielgruppe ansprechen möchte. Wichtig ist vor allem eine Ausrichtung auf eine Zielgruppe. Zu oft positionieren sich regionale Brauereien zu breit, so daß beim Konsumenten kein klares Bild der Marke entsteht. Die Stärken regionaler Brauereien, die nicht zuletzt in der gegebenen Kundennähe - zeitlich und räumlich - liegen, müssen auch in der Kommunikation umgesetzt werden. Kleinere und mittlere Brauereien können durch den gezielten Einsatz ihrer Mittel bei entsprechenden Ereignissen über das hohe "Grundrauschen" der Werbung der Großbrauereien hinausragen. Wie dabei Events, PR, Werbung, etc. optimal per Cross Communication aufeinander abgestimmt werden können, ist zentraler Bestandteil dieser [¿]