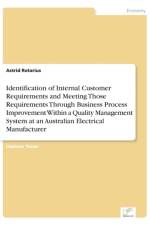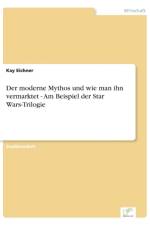- Der Weg zu einem ganzheitlichen Konzept
av Oliver Adam
837
Inhaltsangabe:Problemstellung: Im April 1996 wurde in dem Workshop ?Stadtmarketing von Pro Lörrach? von dem versammelten Forum beschlossen, das Angebot zweier Studenten der Berufsakademie Lörrach Fachrichtung Handel anzunehmen und diese damit zu beauftragen, die Erfahrungen die andere Städte bereits mit Stadtmarketing gewonnen haben, im Rahmen von zwei Diplomarbeiten aufzuarbeiten. Grund für diesen Beschluss war, eine gute Entscheidungs- und Argumentationsgrundlage für Stadtmarketing zu erhalten, einen Überblick über die Ganzheitlichkeit von Stadtmarketing und auch einen Ideenanstoß für dessen Organisation und Gestaltung zu bekommen Die Aufgabe des Autors ist es, in dieser Diplomarbeit erzielte Erfolge und grundlegende Probleme, die bei der Konzeption und Durchführung von Stadtmarketing bisher auftraten, aufzuzeigen. Das Wissen soll dazu dienen, Fehler zu vermeiden und potentielle Problembereiche mit einer gewissen Voraussicht und Sensibilität zu behandeln. Die erzielten Resultate von Stadtmarketing sollen zum einen als Entscheidungsgrundlage und zum anderen als Motivation für das Betreiben von Stadtmarketing dienen. Eine Marketing-Konzeption von Stadtmarketing, angefangen bei der Erstellung eines Leitbildes, über die Realisierung von Maßnahmen, bis hin zu einem Stadtmarketing-Controlling, wird hier als idealtypisches Modell aufgezeigt. Gründe für die Wahl dieses Themenbereiches liegen darin, dass viele Städte, die Stadtmarketing oder ähnliche Konzeptionen betreiben, nur Bruchstücke eines Marketing-Spektrums berücksichtigen. Stadtmarketing soll individuell auf die jeweiligen Städte zugeschnitten und auf deren Problembereiche ausgerichtet werden. Doch fehlt vielen Betreibern von Stadtmarketing der Überblick und das richtige Verständnis von Marketing, das weit über Werbung und Aktionen hinausgeht und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Stadtmarketing ist. Selbstverständlich kann dieses idealtypische Modell nur einen Ansatz darstellen, als Orientierunghilfe dienen und Denkanstöße geben, da ein Gesamtkonzept nur kollektiv von den Entscheidungsträgem in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten am Stadtmarketing ausgestaltet und umgesetzt werden kann. Wie bereits im obigen Abschnitt geschildert, werden in dieser Diplomarbeit Problembereiche und Resultate von Stadtmarketing aufgearbeitet, sowie ein Ansatz einer idealtypischen Stadtmarketing-Konzeption aufgezeigt Ebenso berücksichtigt diese Arbeit grundsätzliche Problembereiche der Organisation und [¿]