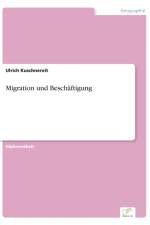- Die Technik fur vernetzte Projekte
av Michael Krippner
951
Inhaltsangabe:Einleitung: Multimedia (MM) ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen arbeiten schon lange mit Multimedia und wissen es gar nicht. Die Technik hinter Multimedia gibt es schon lange. Multimedia ist einfach eine neue Wortschöpfung für die gleichzeitige Nutzung dieser Techniken. "Multi" ist eine lateinische Vorsilbe und heißt soviel wie "viel" oder "vielfach". Der Begriff "Medium", Mehrzahl "Media", kommt ebenfalls aus der lateinischen Sprache und bedeutet allgemein "Mittel" oder "Mittler". Umgesetzt auf Kommunikation heißt Medium soviel wie Mittel, Weg oder Organisation zur Vermittlung von Nachrichten, Wissen oder Unterhaltung. Medien im Sinne von Multimedia sind das gesprochene oder geschriebene Wort, das Bild in allen Formen und die Musik bzw. Audio. Kommunikation mit Multimedia ist dann realisiert, wenn mehr als eins von den genannten Medien benutzt worden ist. So gesehen betreibt ein Künstler mit Gitarrenspiel und Gesang bereits Multimedia, nämlich mit Worten und Musik. Das Ziel aller Formen von Multimedia besteht darin, Sachverhalte anschaulich zu vermitteln. Beim Linearen Multimedia wird der Kommunikationspartner aufgefordert, die Darstellungen mit zu verfolgen, ohne die Möglichkeit das Dargebotene direkt nachvollziehen zu können. Von einem Informationsangebot, das nur gelesen wird, bleiben etwa 10% im Gedächtnis, 20% vom reinem Zuhören, 30% vom nur Sehen und 50% vom Sehen und Hören. Beim interaktiven Multimedia werden die meisten menschliche Sinne angesprochen, und Informationen werden durch Hören, Sehen und Mitarbeit bis zu 80 % aufgenommen. Bereiche der Nutzung dieser integrierten Form aller genannten Kommunikationsmittel sind zum Beispiel, Aus- und Weiterbildung, Werbung, Unterhaltung, Archive und Kataloge, Bedienungs- und Reparaturanleitungen, Informationen über Verkehrswege, Messen, Ausstellungen oder Museen. Das interaktive Multimedia wurde erst mit der Entwicklung moderner Rechner- und Speichertechnik (wie die CD) ermöglicht. Dabei sind die Produktionskosten für eine CD-1 (CD-Interaktiv), im Gegensatz zu einer CD- ROM (Read Only Memory, z.B. für Bestellkataloge), sehr hoch. Zur Zeit faßt eine CD rund 500.000 Schreibmaschinenseiten. Neben dem Rechner mit Peripherie wie Scanner, Fax, Videokamera, Aktivlautsprecher, ISDN-Einschubkarte gehört auch die Kenntnis und der Umgang mit umfangreichen Softwareprogrammen zu Multimedia. Technisch gesehen ist Multimedia die digitale Verarbeitung, [¿]