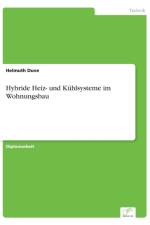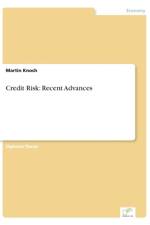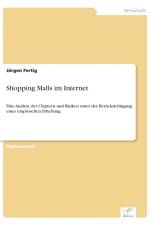- Am Beispiel eines Reihenendhauses
av Frank Weber
1 021
Inhaltsangabe:Einleitung: Wirtschaftlichkeit ist definiert als das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Wirtschaftliches Handeln bedeutet also, dieses Verhältnis so günstig, wie irgend möglich, zu gestalten. Diese kann nach dem Maximal- oder dem Minimalprinzip geschehen, das heißt: Wirtschaftliches Handeln kann sowohl darauf ausgerichtet sein, einen größtmöglichen Ertrag bei vorgegebenem Aufwand als auch einen vorgegebenen Ertrag bei geringstmöglichem Aufwand zu erreichen. Ein solcher Ertrag eines Eigenheimes können Mieteinnahmen sein, wie zum Beispiel bei Vermietung einer Einliegerwohnung. Für Gewerbetreibende ist es möglich und empfehlenswert, für gewerblich genutzte Räume eine sog. kalkulatorische Miete in Ansatz zu bringen. Ein weiterer Ertrag eines Eigenheimes ist sein Wohnwert, nicht zu verwechseln mit dem Verkehrswert. Der Wohnwert wird maßgeblich beeinflußt durch die Wahl des Grundrisses und dessen Anpassung an die Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Bewohner sowie durch die klimatischen Verhältnisse im Haus, die aber ihrerseits abhängig sind von feuchte-, schall- und wärmetechnischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe und deren Verarbeitung. Auch die Ästhetik spielt hier eine Rolle. Der Ertrag Wohnwert kann auch beeinflußt werden durch technische Gebäudeausstattungen wie Bus-Systeme (Insta-Bus), automatische Be- und Entlüftung, Holzöfen jeglicher Art, Solartechnik zur Strom- und Wärmegewinnung, Whirlpool, Sauna, Regenwassernutzung und manche andere zusätzliche bauliche Einrichtungen, die jedoch zuerst als Aufwand und Kosten zu Buche schlagen. Die Aufwendungen für ein Eigenheim setzen sich dann auch zusammen aus der einmaligen Investition, die in Form der jährlichen Kapitalkosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung miteingeht sowie den jährlich anfallenden Betriebskosten, wie zum Beispiel Heizung und Instandhaltung. Auch steuerliche Aufwendungen sind miteinzubeziehen, da Investitionskosten aktivierungsfähig sind. Betriebskosten werden dagegen in dem Jahr abgesetzt, in dem sie entstehen. Damit wirkt sich die Steuergesetzgebung auch auf die Wirtschaftlichkeit von Immobilien und Eigenheimen aus, auf Ertrag und Aufwendungen des Bauherren. Somit ist die Wirtschaftlichkeit von Immobilien nicht nur für Häuslebauer interessant, ob als Selbstbewohner oder als Vermieter, sondern auch für den Staat. Tatsächlich ist auch für die Benutzer und Bauherren eines Hauses diejenige Außenwand- oder Hauskonstruktion wirtschaftlich am [¿]