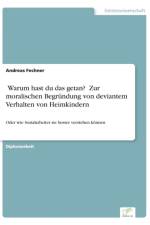- Eine differenzierte Analyse von Migrationspfaden
av Katja Wollersheim
1 167
Inhaltsangabe:Einleitung: Unternehmen der New Economy stehen vor Herausforderungen, die die Existenz dieses Unternehmenstypus mitunter grundsätzlich in Frage stellen. Dass diese Unternehmen jemals mit derartigen Problemen konfrontiert werden würden, hätte zu Beginn des Jahres 2000 als der New-Economy-Hype seinen Höhepunkt erreichte niemand vorausgeahnt. Die Old Economy galt als nicht zeitgemäß, hinter den Entwicklungen zurückgeblieben und nicht mer zukunftsfähig. Heute steht die überwiegende Mehrheit der zumeist sehr jungen New-Economy-Unternehmen vor fundamentalen, existenzgefährdenden Herausforderungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass langfristig ein erheblicher Anteil dieser Unternehmen im Markt nicht bestehen wird. Der Suche nach Überlebensstrategien für Unternehmen der New Economy kommt damit eine zentrale Bedeutung zu, eine Fragestellung, der in Wissenschaft und Praxis zum jetzigen Zeitpunkt nur in Ansätzen nachgegangen wird. Eine ganzheitliche Betrachtung der für ein ?Überleben? relevanten Strategiedimensionen, die auf den Stärken und Schwächen sowohl von Old-als auch von New-Economy-Unternehmen aufbaut, ist bislang nicht erfolgt. Die vorliegende Untersuchung verfolgt deshalb das Ziel, ausgewählte Strategieansätze für New-Economy-Unternehmen im Next-Economy-Umfeld darzustellen und entsprechende, zentrale Migrationspfade anhand von Best-Practice-Beispielen darzustellen. Die vorliegende Arbeit basiert auf der These, dass Überlebensstrategien für New-Economy-Unternehmen auf den eigenen positiven und negativen Erfahrungen als auch den Erfahrungen, die Old-Economy-Unternehmen aufweisen, aufbauen müssen. Auf jeden Fall hat eine Überlebensstrategie die im Unternehmen vorhandenen spezifischen Stärken zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund sind in der vorliegenden Untersuchung zunächst die strategischen Ausrichtungen von Old- und New-Economy-Unternehmen für ausgewählte Strategiedimensionen, wie z.B. Marketing und Vertrieb, Organisation, Finanzmanagement und Personal analysiert worden. Dabei hat sich gezeigt, dass für eine Analyse dieser Strategien das Verständnis der damaligen Rahmenbedingungen, anhand derer sich die Unternehmen ausgerichtet haben, von zentraler Bedeutung ist: Die Frage also, welche Faktoren den Hype um die New Economy letztlich erst ermöglichten. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: VERZEICHNIS DER TABELLENIII VERZEICHNIS DER ABBILDUNGENIV ABKÜRZUNGSVERZEICHNISV 1.DIE ÜBERLEBENSSTRATEGIE ALS HERAUSFORDERUNG [¿]