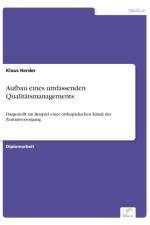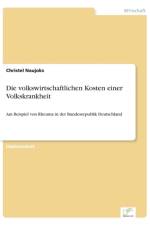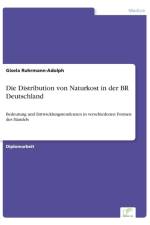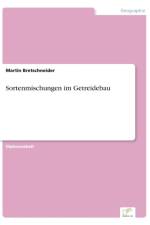- Schutz von geistigem Material in Multimedia
av Alexander Wolf
1 377
Inhaltsangabe:Einleitung: Gegenstand der vorliegenden Informatik-Diplomarbeit ist die Problematik des urheberrechtlichen Schutzes von geistigem Material in Multimedia (Internet, CD-ROM). Ziel ist es, mit dieser Arbeit die derzeit etwas undurchsichtige Thematik des Schutzes von Ton, Bild und Schrift in Multimedia, unter anderem anhand von konkreten Beispielen einer bereits existierenden CD-ROM, zu erläutern. Als Analyse-Objekte empfahl sich das "Bertelsmann Universal-Lexikon" auf CD-ROM. Auf dieser CD-ROM finden sich alle Medien wie Ton (Audio), Datenbanken, Videoanimation, Grafik etc. wieder. Des öfteren werden auch Beispiele aus den weltumspannenden Kommunikationsnetzen wie z.B. dem Internet angesprochen. Mit dieser Arbeit könnte derjenigen Personen, die ihre kreativen Schöpfungen und Ideen im Internet oder auf CD-ROM veröffentlichen möchten, eine An Anleitung gegeben werden, welche Aspekte beachtet werden müssen, um eigene Schöpfungen in der Multimediawelt ausreichend urheberrechtlich zu schützen. Als nützliches "Nebenprodukt" dieser Arbeit wird mit dem Vermitteln von derzeit geltendem Recht dem Leser auch Einblick gewährt, wie sich verhalten werden sollte, um geltende Urheberrechte von bereits bestehenden Werken nicht zu verletzten. Ich könnte mir vorstellen, daß ein leicht verständlicher Ratgeber sich als sehr nützlich erweisen könnte, um kreativen Köpfen und Künstlern die Angst vor Veröffentlichungen im Multimediabereich zu nehmen. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem alle wichtigen technischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte zusammentragen werden, die meiner Ansicht nach Beachtung finden sollten, um geistige Schöpfungen gesichert im Internet und/oder auf CD-Rom zu veröffentlichen. Ich bin davon überzeugt, daß ein eingehendes Studium dem Leser der vorliegenden Arbeit ihm Wissen vermitteln und ihn in die Lage versetzen kann, (s)eine Multimediaidee gesichert in die "virtuelle Realität umzusetzen. Um den Rahmen der Arbeit einzugrenzen, beziehe ich mich ausschließlich auf BRD-Recht. "Fortgeschrittene" rechtliche Ansätze und Entwicklungen aus dem Ausland werden, wenn es sich anbietet, nicht außer acht gelassen. Eine Überschneidung der Bereiche Internet und CD-ROM ließ sich nicht vermeiden, da beide Bereiche zu eng miteinander verbunden sind. Zur Themenwahl dieser Diplomarbeit bewog mich letztendlich meine Neugier, wie bestehendes Recht in ein globales Multimedia-Recht einzubinden ist. Besonders hilfreich war neben der [¿]