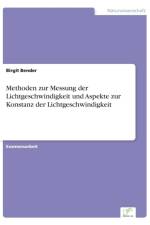- Grundlagen zur Steigerung der Produktivitat und Rentabilitat
av Carsten Doose
861
Inhaltsangabe:Einleitung: ?Nur wer sich an Spitzenleistungen anderer Unternehmen orientiert, hat überhaupt eine Chance, langfristig erfolgreich zu sein.? Eine Aussage, die heute in Deutschland, im Gegensatz zu den USA und anderen führenden Industrieländern, noch nicht zur klassischen Unternehmensführung gehört, obwohl dort aufgrund von Benchmarking, Spitzenleistungen erbracht werden. Zu oft wird sich noch auf eigene Potenziale verlassen und nicht die externe Orientierung, mit der sich gemessen werden kann, gesucht. Oft bleiben damit potentielle Kosten- bzw. Produktivitätsvorteile ungenutzt. Benchmarking ist eine Managementmethode, um Verbesserungen von Leistungen bis hin zu Spitzenleistungen realisieren zu können, was anhand eines kontinuierlichen Anwachsens der internationalen Wettbewerbsfähigkeit eine aktuelle Herausforderung darstellt. Als Bestandteil des ?Total Quality Management? (TQM) ist Benchmarking ein Instrument, das helfen kann, langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität eines Unternehmens zu sichern. Grundsätzlich verdrängt Benchmarking keine anderen Managementtechniken, sondern ergänzt und unterstützt diese. Über fünfundfünfzig Prozent der hundert besten deutschen Unternehmen, haben Benchmarking als Managementinstrument zur Leistungssteigerung angenommen. Benchmarking gewinnt somit zunehmend an Bedeutung in den Reihen der Managementmethoden. Besonders geschätzt ist Benchmarking in seiner, über den klassischen Unternehmensvergleich herausragenden, Fähigkeit nicht nur kurzfristige Leistungssteigerungen, sondern auch langfristiges Erreichen von Wettbewerbsvorteilen zu ermöglichen. Unter anderem hat diese Fähigkeit, Benchmarking zu einem Element einer ganzheitlichen Managementphilosophie gemacht. Problemstellung: Ziel dieser Ausarbeitung ist es, einen Überblick über die grundsätzlichen Inhalte, Elemente, Funktionen und Arten des Begriffes Benchmarking zu vermitteln. Des Weiteren sollen Fragen betreffend des strukturellen Ablaufes von Benchmarking, anhand des Benchmarking-Prozesses geklärt werden. Wie funktioniert Benchmarking und wodurch eignet es sich als Methode zur Leistungssteigerung? Wie kann der operative Bereich der Leistungsfähigkeit und der strategische Aspekt der Rentabilität in einen kausalen Zusammenhang gesetzt werden? Am Ende dieser Diplomarbeit soll der Leser das Instrument des Benchmarking in seiner Art und Funktionsweise verstanden haben sowie die Zusammenhänge zwischen der Leistungssteigerung durch [¿]