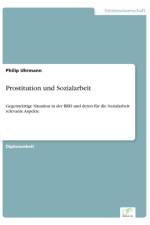- Ein UEberblick
av Freddy Buhl
1 117
Inhaltsangabe:Einleitung: "Handelsmarken sind immer noch oder gerade wieder ein interessantes Thema. Auf der Suche nach Möglichkeiten, sich in der enger gewordenen Handelslandschaft von der Konkurrenz abzuheben, wird wieder verstärkt über die Möglichkeit nachgedacht, sich mit Handelsmarken zu profilieren. Wie das letztlich aussehen soll, scheint jedoch häufig unklar zu sein". Genau hier setzt diese Arbeit an und versucht dazu beizutragen, bestehende Unklarheiten durchschaubarer zu machen oder sogar abzubauen. Auch aus Konsumentensicht kann es vorteilhaft sein, nicht nur verschiedene Arten markierter Waren unterscheiden zu können, sondern auch über ein entsprechendes Hintergrundwissen zu verfügen. Gang der Untersuchung: Am Beginn der Untersuchung wird in Kapitel 1 und 2 neben einem kurzen Abriß des Markenrechts (WZG, EU-Markenrechtsrichtlinie u.a.) festgelegt, welche Inhalte den zu verwendenden Begriffen zugeordnet werden sollen. So besteht das Wort "Handelsmarkenpolitik" aus den Begriffen "Handel", "Marke" und "Politik", enthält aber gleichzeitig die Zusammensetzungen "Handelsmarke" und "Markenpolitik". Weitere wichtige Begriffe sind neben dem sehr problematischen Terminus "Markenartikel", z.B. Erstmarke und Zweitmarke, Herstellermarke, Fabrikmarke, Industriemarke, Lieferantenmarke, Händlermarke, Eigenmarke, Hausmarke, Private label, marque de commerce, Gattungsmarke, No Names, Weiße Produkte, Generics, Markierung, markierte und unmarkierte Waren. Nach den Begriffsbestimmungen und grundlegenden Zusammenhängen werden die Elemente der Handelsmarkenpolitik, d.h. die "klassische Handelsmarke" in Kapitel 3 und die "Gattungsmarke" in Kapitel 4 sehr eingehend untersucht. Dabei wird nicht nur den Fragen, nach den Entstehungsursachen und der bisherigen Entwicklung, nachgegangen, sondern es werden auch die jeweiligen Zielsetzungen aufgezeigt. Ein tieferes Eindringen in die Thematik führt in Kapitel 5 zur Betrachtung der Handelsmarkenpolitik im Rahmen der absatzpolitischen Instrumente (Preispolitik, Produktpolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik), um so das Verständnis für diesen Bereich des Handelsmarketings zu fördern und weitere Teile des Fachgebiets `Marketing' zu erschließen. In Kapitel 6 erfolgt eine Wertung der Handelsmarkenpolitik aus der Sicht der Hersteller, des Einzelhandels sowie der Gesellschaft und der Konsumenten. Auf der Basis der bis dahin erarbeiteten Erkenntnisse wird der "Überblick über die Handelsmarkenpolitik" [¿]