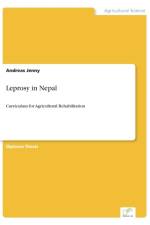- Traditionelle Instrumentalmusik der Juden Osteuropas
av Susi Hudak
1 241
Inhaltsangabe:Einleitung: Mitte der 1970er Jahre nahm in den USA eine Revivalbewegung jüdischer Musik ihren Anfang, die eine osteuropäisch jüdische Musiktradition wiederbeleben wollte, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa nahezu verschwunden war. Die Musiker aus der "Neuen Welt", größtenteils selber Kinder oder Enkel jüdischer Einwanderer, begannen sich für die Gebrauchsmusik ihrer Vorfahren in der "Alten Welt" zu interessieren. Es war die traditionelle Musik, die vor allem zu jüdischen Hochzeiten und religiösen Festtagen, aber auch bei Umzügen, Bällen und in Gasthäusern und Herbergen, sowohl zu jüdischen als auch zu nichtjüdischen Feierlichkeiten gespielt wurde: Die KIezmer-Musik. Das Klezmer-Revival bezieht sich in seinem wiedererwachten Interesse für jüdische Volksmusik auf die Musizierpraxis im "Alten Europa" und gleichermaßen auf die "Alten Zeiten" der Einwanderungsperiode in die USA im ersten Drittel dieses Jahrhunderts. Um einschätzen zu können, was da wiederbelebt wurde, bedarf es eines umfassenden Bildes von der Musik und den Musikern aus der Zeit vor der grenzenlosen Stilvermischung und Stlldiversität, wie sie heutzutage in der Klezmermusik zu finden ist. Es wird hier also die ehemals traditionelle instrumentale Volksmusik der Juden Osteuropas näher zu betrachten sein, bzw. das, was sich davon noch rekonstruieren läßt. Die leitende Fragestellung dieser Arbeit soll demzufolge lauten: Wie sah die Musik aus, auf die sich das Klezmer-Revival gründet? Die Musik der Revival-Bewegung selbst, von ihren Rekonstruktionen bis zu ihren Weiterentwicklungen mit inhaltlichem, stilistischem und funktionalem Wandel, soll hierbei außer Betracht gelassen werden. Gang der Untersuchung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein möglichst differenziertes Bild von osteuropäischen Klezmer-Musikern und ihrer Musik zu entwerfen, das viele verschiedene Aspekte erfassen soll. Musikalisch unmittelbar bedeutsam sind Fragestellungen nach dem Instrumentarium und den Instrumentenzusammenstellungen, dem Repertoire und den darin unterscheidbaren Stiltypen, den verwendeten Skalen sowie den melodischen, rhythmischen und harmonischen Besonderheiten. Einen anderen Bereich bilden Funktion und Stellenwert der Musik, die Gelegenheiten, zu denen die Musiker aufspielten und deren Sozialstatus. Ferner sollen Einflüsse und Wechselwirkungen zwischen jüdischer und nichtjüdischer Musik bzw. zwischen Musik unterschiedlicher lokaler Herkunft thematisiert werden. Im Rahmen dieser [¿]