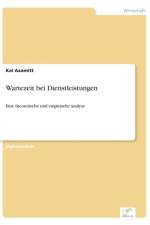- Eine empirische Untersuchung zum Einfluss des Involvements auf das Konsumentenverhalten gegenuber Marken-Websites und die Konsequenzen fur die Kommunikationsstrategie
av Verena Birkendahl
1 261
Inhaltsangabe:Einleitung: In der Diskussion um Markenauftritte im Internet haben Begriffe wie Interaktivität, Personalisierung und Kundenbindung Hochkonjunktur. Sogar von einer Revolution der Marktkommunikation ist die Rede. Es scheint kein Zweifel daran zu bestehen, dass jede Marke mit einer eigenen Website im Internet präsent sein muss, um möglichst viele der neuen Möglichkeiten auszunutzen. Aber häufig tritt der gewünschte Erfolg solcher Marken-Websites nicht ein. Warum bleiben oftmals die Klicks aus, obwohl die Website doch die Kommunikation zwischen Konsument und Marke revolutionieren soll? Das Problem liegt darin, dass vor lauter Internet-Euphorie oft nur die neuen Möglichkeiten gesehen werden, die das Internet eröffnet, nicht aber die zusätzlichen Anforderungen, die es an die Marktkommunikation stellt. Sie machen ein Umdenken auf Seiten der Werbetreibenden notwendig. Dies kann durch ein Bild veranschaulicht werden. Klassische Werbung ist wie ein Schlauch, mit dem man möglichst viele Passanten nass spritzen möchte. Man muss in der Reichweite des Konsumenten sein und bedenken, dass große Schläuche mehr Passanten nass spritzen als kleine. Die Trefferquote ist häufig nicht sehr hoch und freiwillig lässt sich niemand nass spritzen. Eine Website hingegen ist wie die Bereitstellung eines Pools. Der Passant entscheidet, ob er hineinspringt oder nicht, wann er dies tut, wie lange er drin bleibt und wann er wiederkommt. Die Herausforderung für die Marktkommunikation besteht nun darin, attraktive Pools zur Verfügung zu stellen. Die Konsumenten müssen einer Marke Interesse entgegenbringen und ?in den Pool springen?, damit eine Kommunikation über die Website zustande kommt. Auch im Rahmen der klassischen Werbung ist dieses Involvement der Konsumenten von Bedeutung, denn es wirkt sich auf die Intensität der Werberezeption aus. Für die Kommunikation per Website dürfte es jedoch eine noch wichtigere Rolle spielen, da die Konsumenten hier nicht nur passiv Botschaften aufnehmen sollen, sondern selbst aktiv werden müssen. Dennoch drängen auch Low-Involvement-Marken mit viel Aufwand ins Internet und erwarten, dass sich die Konsumenten für ihre Websites interessieren. Bei solchen Auftritten sind häufig zwei Arten von Problemen zu beobachten: Oftmals wird zu sehr von der Marke aus gedacht. Wenn die Inhalte der klassischen Werbung weitgehend identisch ins Internet übertragen werden, um dort die gewohnte Markenwelt wiederzugeben, so wird dies nicht den [¿]